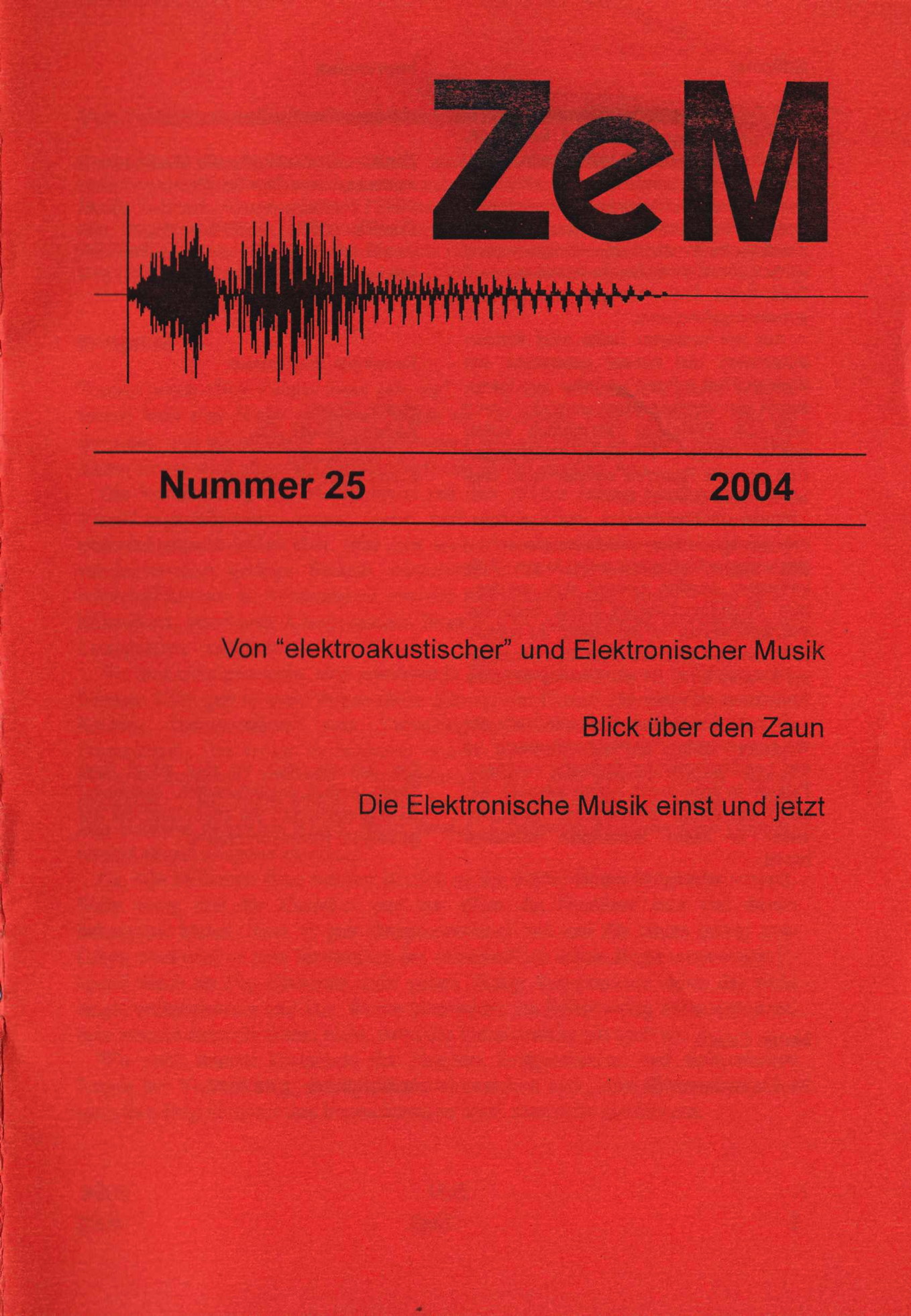Elektronische Musik, Computer-Musik, elektroakustische Musik,
elektrische und elektronische Musikinstrumente, mechanische
Musikinstrumente, Musikautomaten, E-
Musik, U-Musik, Akustik, Elektrik, Elektronik, wir haben eine
babylonische Sprach- und Begriffsverwirrung in der Öffentlichkeit,
die zudem noch durch fehlerhafte Publikationen verschlimmert wird.
Vielleicht hilft es, wenn man nach dem historischen Ursprung dieser
Bezeichnungen und den damit verbundenen Ideen sucht.
Ereignisse
"Love-Parade-Chef Fabian Lenz gibt auf", so konnte ich
kürzlich lesen. Wieder einmal ebbt eine Welle populärer Musik
ab, in diesem Falle "Techno". Ich bin gespannt, was als nächstes
herangeschwappt kommt. Eines ist aber schon sicher: dieses Etwas wird
allein auf elektroakustische Mittel gestützt sein.
Die Vermarktung von Musik findet seit den 1950er Jahren
(Aufkommen der Vinyl-Langspielplatte) immer mehr und heute fast
ausschließlich durch elektroakustische Mittel statt. Wer geht
noch ins Konzert und was erbringt dieser vergleichsweise geringe Besuch
wirtschaftlich für den Musiker? Musik ist wirtschaftlich nur in
Abhängigkeit von der elektroakustischen Kette - also z. B.:
Mikrophon, Mischpult, Klangspeicher, Master, CD, Abspielgerät,
Verstärker und Lautsprecher - möglich.
Wo dies nicht geschieht, sind gravierende
Einsparmaßnahmen zu befürchten. Im Sommer 2003 gab es eine
"folgenreiche Sitzung der Gema" [1]. Die Gema ist die Rechte-,
Geldeinnahme- und Verteilungsinstitution der Musikbranche in
Deutschland. Ein neuer Aufsichtsrat wurde gewählt, der bis dahin
"gültige Konsens zwischen schnöder Unterhaltungsmusik und
ernster Musik wurde gekündigt ... alle sechs Plätze wurden
frech von der U-Fraktion besetzt ... Der Pop meuterte gegen die Kunst.
Hans Zender, Komponist der Oper Don Quijote, verließ
türenschlagend den Saal."
Ca. 300 Millionen Euro werden jährlich an die 60000
Gema-Mitglieder verteilt. Nicht etwa, daß die Klassiker und vor
allem die Neutöner sehr viel davon bekommen hätten. Aber es
gab überproportional viel und für einige genug zum Leben. Nun
wird es kein Sponsoring der wirtschaftlich schon längst
unrentablen E-Musik durch die Pop-Elaborate mehr geben. Einige
Komponisten haben das wohl längst vorhergesehen und ihre Werke
konsequent im Selbstverlag herausgebracht, man braucht dazu die Gema
nicht, denn das Urheberrecht gilt auch so.
Wie auch immer: Ereignisse der jüngsten Zeitgeschichte,
und insbesondere Fragen der Vermarktung, der Publikumswirksamkeit usw.,
sind für unsere Suche nach dem Begriff hinter den Bezeichnungen
wohl eher nicht zielführend.
U und E
Die Unterscheidung zwischen U- und E-Musik war schon immer
problematisch, immer subjektiv, nie ohne persönliche Wertung. Ein
objektiveres Kriterium ist dagegen der Informationsgehalt in einem
Stück. Ein Schlager kann auf einem Bierdeckel notiert werden.
Musik mit Bedeutung über den Tag hinaus wird zwangsläufig
komplexer sein, mehr "Notenpapier" benötigen, damit sie auch nach
Jahrzehnten immer noch bisher unentdeckte Details bietet, die das
Wiederhören weiterhin spannend machen. Dabei sollte
außermusikalische Information keine Berücksichtigung finden,
ein langweiliges Stück wird durch seitenlanges, blumiges
Schrifttum auch nicht besser. Man kann also informationstheoretisch
neutraler von einfach oder simpel strukturierter Musik und komplex,
oder reich strukturierter Musik sprechen. Über die
künstlerische Wirkung besagt dies einiges, aber nicht alles,
immerhin ist es besser als, U und E. Komplexe Musik tendiert damit zur
Absoluten Musik, sie kümmert sich weder um den Zeitgeschmack, den
Rundfunk- oder Stadtrat noch um ihre eigene Vermarktbarkeit. Sie ist
Kunst nur für sich, sie dient keinem Zweck, sie ist einfach.
Die simple Musik dagegen muß den kleinsten gemeinsamen
Nenner der potentiellen Käufer ansprechen: Deppen-Techno und
Mutantenstadel. Sie ist bestenfalls Gebrauchsmusik, zu Zwecken der
Entspannung, des Ablenkens von Problemen oder zu Zwecken der
gesellschaftlichen Repräsentation. "Das Maß von Geist, das erforderlich
ist, um uns zu gefallen, ist ein ziemlich genauer Gradmesser für
den Geist, welchen wir besitzen" (Arthur Schopenhauer).
Wie wäre es mit "Die Lustige Witwe", vielleicht
kombiniert mit 20 Tenören? Dazu als Sauce ein Dutzend bekannte
Melodien, zwangsgewalzt von André Rieu? Da gibt es kein Vertun:
bestimmte und nicht zu kleine Bereiche der Verkaufssparte "Klassik"
sind eindeutig simpel, seicht, Gala-Auftritte mit Starkult. Zur Zeit
sind spärlich bekleidete Violinistinnen in Mode, natürlich
elektroakustisch verstärkt. Es wäre eine
musikwissenschaftliche Untersuchung wert, ob die populäre Musik
seit 1960 stetig in einer Verblödungsspirale hinabtrudelt.
Möglicherweise erscheint dies nur so. Wenn nicht: es gibt leider
keinen absoluten Nullpunkt der musikalischen Stupidität, der den
freien Fall aufhalten könnte.
Sollte aber der Musikkabarettist Hans Liberg in Ihre Gegend
kommen: hingehen! Liberg kennt sie alle, er ist schließlich
diplomierter Musikwissenschaftler und rechtmäßiger, wenn
auch zotiger Erbe Victor Borges. Er zieht sie gnadenlos durch den
Kakao, vor allem Rieu, die Bohlens und Beatles dieser Welt, aber auch
Mozart und Co. bekommen ihr Fett weg. Sein letztes Programm hieß
"Tatatataaaa", lautmalerisch Beethovens Nr. 5 markierend. Libergs Witz
entlarvt die innere Beschränktheit der Musik, jawohl: auch die der
"Klassik". Freundlicher ausgedrückt heißt das: Personalstil.
Immer wiederkehrende Elemente, Selbstbezug, Zirkelschluß. Liberg
macht Ihnen mit drei Anschlägen den Mozart aus einer Schnulze wie
"Yesterday". Auch die "Neue Musik" kriegt natürlich ihr Teil.
Damit hier kein Mißverständnis aufkommt: ich habe gar nichts
gegen die "leichte Muse". Man kann nicht immer Kaviar essen, Brot und
Butter muß es auch geben, sauberes Musikantenhandwerk, das auch
genau als solches verstanden wird.
Geschichte
Einige wenige Musiker haben um 1900 klargesehen: die
Stagnation, die das überlebte "klassische" musikalische Konzept
und seine Randerscheinungen mit sich bringen. Ferrucio Busoni
drückte es so aus: "Plötzlich
eines Tages, schien es mir klar geworden: daß die Entfaltung der
Tonkunst an unseren Musikinstrumenten scheitert .... Wenn "Schaffen",
wie ich es definierte, ein "Formen aus dem Nichts" bedeuten soll ...
wenn Musik ... zur "Originalität" nämlich zu ihrem eigenen
reinen Wesen zurückstreben soll ... wenn sie Konventionen und
Formeln wie ein verbrauchtes Gewand ablegen und in schöner
Nacktheit prangen soll ... diesem Drange stehen die musikalischen
Werkzeuge zunächst im Wege. Die Instrumente sind an ihren Umfang,
ihre Klangart und ihre Ausführungsmöglichkeiten festgekettet,
und ihre hundert Ketten müssen den Schaffenwollenden mitfesseln.
Vergeblich wird jeder freie Flugversuch des Komponisten sein; in den
allerneuesten Partituren und noch in solchen der nächsten Zukunft
werden wir immer wieder auf die Eigentümlichkeiten der
Klarinetten, Posaunen und Geigen stoßen, die eben nicht anders
sich gebärden können, als es in ihrer Beschränkung
liegt; dazu gesellt sich die Manieriertheit der Instrumentalisten in
der Behandlung ihres Instrumentes; der vibrierende Überschwang des
Violoncells, der zögernde Ansatz des Hornes, die befangene
Kurzatmigkeit der Oboe, die prahlhafte Geläufigkeit der
Klarinette; derart, daß in einem neuen und selbständigeren
Werke notgedrungen immer wieder dasselbe Klangbild sich zusammenformt
und daß der unabhängige Komponist in all dieses
Unabänderliche hinein- und hinabgezogen wird" [2].
Das Bild ist zutreffend: die Musik ist auch durch andere
solcher Ketten festgezurrt, nicht in der Lage, sich zu bewegen. Der
Musikant am Instrument ist dem Schaffenwollenden nicht immer hilfreich.
Das reicht von völliger Ablehnung der Partitur bis zu manchmal
extremen gewerkschaftlichen Forderungen zur Aufführung, die mit
rechtmäßiger Entlohnung nichts zu tun haben. Das Spielen der
mechanischen Instrumente ist eine weitere Beschränkung. Man kann
z. B. viel schnellere Tonfolgen hören, als damit spielen. Wo endet
der Rhythmus und wo beginnt ein neuer Klang, das Umschlagen einer
Qualität in eine ganz andere durch Quantität, und was ist
überhaupt Klang? Welche Rolle spielt eigentlich Zeit in der Musik?
Die althergebrachte Musiktheorie hat keine Antworten auf diese Fragen.
Das "Warum?", diese menschlichste aller Fragen interessiert dort nicht
besonders, statt dessen: "das haben wir immer so gemacht, ist eben
Tradition". Erst "Die Lehre von den Tonempfindungen als Physiologische
Grundlage für die Theorie der Musik" vom Physiker und Physiologen
Herman von Helmholtz brachte hier etwas mehr Licht ins heuristische
Treiben der Praktiker und markiert einen Beginn tiefergehender
Forschung.
Mechanik
Es war von mechanischen Musikinstrumenten die Rede. Hierbei
muß ein gravierendes Mißverständnis angesprochen
werden: Xylophon, Geige, Orgel, Pauke und Klavier sind nicht
"akustische" Instrumente. Denn das Schwingen einer Membran oder einer
Saite ist zunächst einmal ein Problem der Physik, genauer der
klassischen Mechanik, der ewig jungen Urmutter der Physik, der Lehre
von den Kräften und den daraus resultierenden Bewegung der
Körper.
Die Akustik ist das Teilgebiet der Physik, das die Ausbreitung
von Schallwellen in einem Medium wie Luft, Wasser oder gar Beton
beschreibt. Angeregt werden diese Wellen fast ausschließlich
durch mechanische Schwinger, z. B durch die Membran der Trommel, aber
auch genauso durch die Membran des Lautsprecherchassis. Die
Beeinflussung des mechanischen Systems durch die akustische Abstrahlung
ist dabei meist vernachlässigbar gering, die mechanischen Verluste
überwiegen.
Ein Lautsprecher ist demnach mit voller Berechtigung auch
"akustisch", er ist genauer ein
elektromagnetisch-mechanisch-akustisches Mischsystem. Die
herkömmlichen Instrumente sind mechanisch-akustische Mischsysteme.
Es geht noch weiter: die Grundlage der Akustik ist die
Wellendifferentialgleichung und diese beruht vor allem auf den drei
grundlegenden Gesetzen der Mechanik zuzüglich der
Materialeigenschaften, wo wiederum die Mechanik entscheidend eingeht.
Man könnte vermuten, daß am ehesten noch das Schwingen der
Luftsäule in der Orgelpfeife "akustisch" ist. Orgeln enthalten
Labial- und Lingualpfeifen, bei ersteren ist die Strömungsmechanik
zuständig, bei letzteren kommt noch ein mechanischer Schwinger -
die Zunge - hinzu. Die herkömmlichen Instrumente sind also
ausnahmslos mechanisch-akustische Apparate.
Die mechanischen Musikinstrumente sind nicht zu verwechseln
mit den mechanischen Musikautomaten, also Orchestrion, Drehorgel,
Pianola usw., bei denen zusätzlich zur mechanischen Klangerzeugung
eine mechanische Abspielvorrichtung hinzukommt, also kein Musikant
benötigt wird. Diese sind aber auch mechanisch-akustische
Mischsysteme. Die (kürzere) Bezeichnung "mechanisch" ist für
die herkömmlichen Instrumente daher voll gerechtfertigt,
spezifisch und sinnvoll, die Bezeichnung "akustisch" dagegen für
sich allein unsinnig und unspezifisch, denn alles was klingt, ist mit
Recht irgendwie "akustisch". Vermutlich will man nicht gerne das Wort
"mechanisch" benutzen, weil damit auch die Nebenbedeutung von
"automatenhaft" einhergeht und welcher Künstler will damit schon
assoziiert werden?
Dies sind einfache Tatsachen, die aber weithin ignoriert
werden. Truax bietet in [9] ein schönes Beispiel. Zuerst
erklärt er ganz richtig die Problematik, wenn Laien mühevoll
errungene Begriffe z. B. der Physik aufgreifen und entstellt oder in
falschem Zusammenhang benutzen. Und zwar, weil dies zumindest in der
Öffentlichkeit ein vollkommenes Chaos der Begrifflichkeiten
anrichtet, das die Kommunikation unnötigerweise erheblich
behindert. Siehe dazu auch die Reaktion auf Stockhausens "Wie die Zeit
vergeht". Natürlich steht es jedem frei, sein eigenes "Neusprach"
zu entwerfen, die dringend notwendige interdisziplinäre
Kommunikation wird er aber damit eher nicht fördern.
In einem weiteren Kapitel begeht Truax dann selbst genau
diesen Fehler. Offenbar ohne Sachkenntnis der Mechanik, Akustik,
Elektronik usw. (Truax ist Komponist, aber nicht Ingenieur oder
Physiker, allerdings hält er einen "B. Sc. in physics, mathematics
and music", das macht die Sache nur schlimmer) bezeichnet er die
herkömmlichen Musikinstrumente als "akustisch", "physisch" oder
"physikalisch", das Wort "mechanisch" kommt aber nie vor. Er
konstruiert im weiteren einen Unterschied zu elektronischen oder
elektro-akustischen Apparaten, diese seien demnach eben nicht
"physisch" und nicht "akustisch". Truax spricht auch davon, daß
die elektrischen Mittel etwas "unnatürliches" an sich hätten,
als Beispiel bringt er die u. U. extrem hohen Lautstärken, die
dadurch möglich würden. Ist das so? Man stelle sich hier nur
einmal eine große Trommel vor. Die mechanischen Instrumente sind
in der Tat so laut, daß Schwerhörigkeit eine anerkannte
Berufskrankheit von Orchestermusikern ist! Das Buch von Truax hat in
diesem Bereich nichts zu bieten, hier werden Sachverhalte
zurechtgebogen. Aber die Rückschlüsse, die man durch solche
Schriften auf soziale und psychische Erscheinungen im Bereich der Musik
ziehen kann, sind äußerst interessant. Später komme ich
noch einmal darauf zurück.
Andere Musik
Bis etwa 1930 konnten die Träume von einer anderen,
komplexeren Musik wegen der materiellen Bedingungen (siehe Busoni)
nicht umgesetzt werden. Verzögert durch den zweiten Weltkrieg war
es 1949 aber soweit, das Wort "Elektronische Musik" (E. M.) taucht
höchstwahrscheinlich zum ersten Mal in der deutschen Sprache auf,
im Kompendium "Elektrische Klangerzeugung. Elektronische Musik und
synthetische Sprache" [3]. Bis dahin sprach man nur von "elektrisch".
Der Wortschöpfer und Autor war Werner Meyer-Eppler,
Kommunikationstheoretiker, Physiker, Phonetiker, Klangexperimentator,
und vor allem früher Theoretiker und unermüdlicher
Wanderprediger in Sachen E. M. Das hatte eine ganz einfache, materielle
Grundlage: Meyer-Eppler hatte zu seiner Zeit als einer der ganz wenigen
Menschen auf dem Planeten Zugriff auf die modernsten Geräte, auf
Ton- und Impulsgeneratoren, auf elektronische "Spielinstrumente" wie
Harald Bodes Melochord, auf elektrische Filter und vor allem auf das
Magnetophon oder Tonband (AEG, Funkausstellung 1935), das zum ersten
Mal in der Geschichte die komfortable, qualitativ hinreichende
Speicherung, Archivierung und Manipulation von Klang erlaubte. Andere
hantierten da noch mit Schallplatten oder Stahldrahtaufzeichnung.
Meyer-
Epplers Klangbeispiele mit ihrem neuen Klang - in freilich oft
althergebrachter Form - setzten bei seinen zahllosen Vorträgen
Musik- und Ingenieurswelt gleichermaßen in Erstaunen, dies war
wirklich unerhört.
Auch philosophisch gesehen war damit etwas ganz Neues in die
Welt gekommen, man würde heute sagen: das Entfallen der
Echtzeitbedingung. Denn vorher wurde Musik von Musikern so gut sie es
eben vermochten in dem Augenblick erzeugt, in dem sie auch schon
verklang. Musik war vorher Kunst in (Abhängigkeit von) der Zeit,
während die bildende Kunst dazu im Gegensatz Kunst des Raumes ist,
im Raum gestaltet. Mit dem Magnetophon war es nun aber möglich,
Klangereignisse vorzuproduzieren, um sie dann später über
Lautsprecher abzustrahlen. Gleichzeitiges kann dabei nachzeitig,
Nachzeitiges gleichzeitig, Langsames schnell und Schnelles langsam
werden, Unliebsames kann herausgeschnitten werden, ja es kann sogar die
Kausalität aufgehoben werden: man hört die Saite aus dem
Nichts - ohne Ursache - anschwingen, immer lauter und heller, bis -
entgegen aller Physik - der Filzhammer die Energie mit einem Schlag
abführt, das Piano verstummt. Dazu muß man das Band
bloß rückwärts abspielen. Die Zeit kann beliebig
gedehnt oder gestaucht werden, aus kurzen Impulsen werden so
langanhaltende Klänge und umgekehrt. Und man kann die Struktur der
Klänge gleichsam in Zeitlupe hören und tiefer verstehen, als
je zuvor. Das Tonband machte den Schaffenden damit vom Sklaven zum
Herren der Zeit, eine ganze Menge der lästigsten Busonischen
Ketten waren damit abgeschüttelt. Musik ist seitdem nicht nur
Kunst in der Zeit, sondern Kunst der Zeit und nähert sich somit
der bildenden Kunst an.
Meyer-Eppler war offenbar ein vorausschauender Mensch und er
machte eine ganz entscheidende Aussage: "Musik ist nicht schon dann
"elektronisch" zu nennen, wenn sie sich elektronischer Hilfsmittel
bedient, da es hierzu keineswegs genügt, die bereits vorhandene
Tonwelt oder gar eine bestehende Musik ins Elektroakustische zu
übertragen" [3]. Er sah also voraus, daß sich Musik in nur
wenigen Jahren praktisch nur noch elektroakustisch verbreiten
würde. Und dies erzwingt die Einbeziehung elektronischer Apparate.
Elektronik
Elektrisch sind allgemein die Erscheinungen, die
Ladungen, Ströme, Potentiale, elektrische und magnetische Felder
hervorrufen und / oder interagieren lassen. Man nennt das
"klassische Elektrodynamik". Elektrische Maschinen nutzen z. B. die
Leitfähigkeit von Kupferdraht, das Vorhandensein von Feldlinien um
eine Spule, die Anwesenheit von beweglichen Elektronen in astronomisch
großer Zahl als quasi kontinuierlichen Fluß. Elektronische
Vorrichtungen stehen nicht außerhalb dieser Erscheinungen, aber
sie nutzen zusätzlich feinere Effekte auf die Elektronen aus und
verändern damit in sehr starkem Maße die Leitfähigkeit
von Strombahnen, die Granularität elektrischer Ladung kann dabei
sichtbar werden. Diese Effekte lassen sich meist nicht mehr klassisch
verstehen, hier regiert die Quantenmechanik. Es treten insbesondere
verstärkende Wirkungen auf Strom und Spannung auf, also aktive
Schaltungen. Die erste elektronische Vorrichtung mit Verstärkung
war die Triodenröhre (1906/7, De Forest, von Lieben). Das Gitter
steuert dabei in beispielhafter Weise die Leitfähigkeit der
Strecke Kathode-Anode in verdünntem Gas oder im Vakuum. 1948 wurde
auf einem Germaniumkristall der erste Transistor hergestellt, der Rest
der Entwicklung bis hin zu Chips mit mehr als 100 Millionen
Transistoren ist jedem heute bekannt.
Die "elektrische" Gitarre mit Verstärker und Lautsprecher
ist demnach ein mechanisch-elektrisch-elektronisch-akustisches
Mischsystem. Wenn man kürzt, so soll man gerade den wesentlichen
Teil nicht abschneiden, "elektrische Gitarre" ist demnach die beste
Kurzform, weil hier der entscheidende Klanganteil herrührt, es
heißt nicht "elektronische Gitarre", auch nicht "mechanische
Gitarre" und noch weniger "akustische Gitarre".
Elektronische Musik
Es war also vorhersehbar, daß - von der
verfahrenstechnischen Seite aus - jede Musik zur "elektronischen"
werden würde. Denn physikalisch-elektronische Effekte kommen in
der Elektroakustik immer zum Einsatz, und sei es nur, um die circa 80
dB Dynamik eines großen Orchesters auf Zimmerniveau zu pegeln,
oder den Klang des Flügels nach Tonmeisterart zu manipulieren. Die
elektronische Musik im weitesten Sinne wäre also sehr bald ein
sinnleerer Begriff, der alles und nichts kennzeichnete, jedes
Haushaltgerät sondert heute irgendwelche elektronischen
Piepstöne ab. So steht es denn auch im Lexikon [4]. Die naive
Definition "elektronische Musik entsteht, wenn elektronische Apparate
eingeschaltet werden", führt also nur zu Unsinn.
Meyer-Eppler und seine Mitstreiter, der Musiker Herbert
Eimert, der Musiker und Tonmeister Robert Beyer und der Tonmeister
Fritz Enkel, hatten da etwas ganz anderes im Sinn, als sie am
18.10.1951 am NWDR (heute WDR) die Gründung des weltweit ersten
Studios für E. M. erreichten. Wie das in dieser Zeit des Mangels
und der Trümmer politisch genau bewerkstelligt wurde, kann wohl
heute niemand mehr sagen. Jedenfalls können die ersten drei (oder
alle vier?) in der geschichtlichen Konsequenz als Erfinder der E. M.
gelten. Dies gilt nicht für Karlheinz Stockhausen (zu dieser Zeit
in Paris), der dies aber in einem späteren Interview erst nach
zweimaligem, hartnäckigem Nachfragen einräumte. Die Musik
tendiert eben dazu, "Techniker" wie Enkel oder "Theoretiker" wie Eimert
und Meyer-Eppler schnell und gänzlich zu vergessen.
Ebenso interessant wäre es zu fragen, wieso diese
Entwicklung nicht in den USA stattfand, in einer Situation der
materiellen Fülle aus dem gewonnenen Krieg, zudem begünstigt
durch den gerade endgültig etablierten technologischen Vorsprung
gegenüber Ex-Nazi-Deutschland und Europa.
Meyer-Eppler, Eimert und Beyer sahen in der E. M. als
Gattungsbegriff - also im engeren Sinn [5] - eine radikale Abkehr von
der offensichtlichen Stagnation der bisherigen Musik, vom menschlichen
Interpreten und damit besonders von der zur Zirkusvorstellung
verkommenen Konzertpraxis. "Authentische, auf Tonband oder Schallplatte
vorliegende Kompositionen vermöchten gewiß auch der
Einseitigkeit der gegenwärtigen Programmgestaltung zugunsten einer
größeren Vielfalt aufzuheben; die Einseitigkeit, d. h. die
bis zum Überdruß getriebenen, häufigen Wiederholungen
gewisser Standardwerke auf der einen Seite und die Scheu, unbekannte
Werke neu in das Programm aufzunehmen, beruht im wesentlichen auf
merkantilen Gründen. Der umfangreiche und kostspielige
Orchesterapparat gestattet keine Experimente und das mit ihnen
verbunden finanzielle Risiko." [3].
Diese neue Kunstform der E. M. hat mit der bloß naiv
elektronisch zu nennenden Musik überhaupt nichts gemein. Die
Elektronik ist nicht oberflächlicher Effekt - wie es leider nur zu
oft beim Einsatz solcher Mittel festzustellen ist - sondern: "Der
elektronische Komponist muß nachweisen, daß er seine
Kompositionsideen mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr hätte
realisieren können; bloße Anwendung elektronischer Mittel,
um Modernität vorzutäuschen, ist Trug" [3].
Eine Variante darf hier nicht unterschlagen werden: die
Musique Concrète vor allem des Pierre Schaeffer entstand in
Paris schon 1943 aus dem Club d'Essai und hatte als erstes Werk 1948 im
Concert des Bruits die Étude aux Chemin de Fer. Ausgangspunkt
waren hier also konkrete Klänge, zunächst auf Schallplatten,
dann auf Band, das sind alle Klänge die per Mikrophon aufnehmbar
sind, wie z. B. die Geräusche der Lokomotiven. Schaeffers Motto
war der frühen Arbeitsweise aus Köln genau entgegengesetzt,
das Ohr hatte demnach letztendlich über die Komposition zu
entscheiden, also praktische Komposition nach Gehör statt
Konstruktion vor dem Hören.
In den USA gab es um 1949 (Privatstudio Barron) und 1951
(Ussachevsky und Lüning) die - gegenüber den
europäischen Entwicklungen harmlos wirkende - Music for Tape.
Diese zog allerdings einen John Cage in ihren Bann, der unabhängig
davon als letzte wichtige Komponente der "Neuen Musik" und auch der E.
M. den Zufallsprozeß beisteuerte. Der Komponist gibt nur noch den
Raum der Möglichkeiten vor, der Zufall führt dann die
Struktur in diesen Möglichkeiten aus.
Nach anfänglichen Unstimmigkeiten zwischen Paris und
Köln - man sprach scherzhaft von einem "zweiten eisernen Vorhang"
- wurden die konkreten Klänge neben den synthetisch hergestellten
Klängen als gleichwertig akzeptiert und den damals möglichen
Prozessen der Verarbeitung zusammen unterworfen. Dies war nur logisch,
da in Köln neben Rauschen und Sinustönen immer komplexere
Schwingungen mit immer komplizierteren Spektren benutzt wurden, so
daß klanglich ohne weiteres eine Annäherung zu bestimmten
konkreten, meist geräuschhaften Klängen stattfand. Als erstes
Stück dieser Vereinheitlichung wird Stockhausens "Gesang der
Jünglinge ..." von 1955-56 angesehen. Man stellte bald fest,
daß die extreme "deutsche Ordnung" in der totalen Serialität
oft klanglich ununterscheidbar zu total zufälligen Kompositionen
wurde. Insofern war hiermit auch bald der einstige Gegensatz
"Konstruktion" und "Intuition" aus praktischer Sicht hinfällig.
Da die wesentlichen Verfahrensweisen (von Realzeit völlig
entkoppelte Montage, Filterung, Generatoren) schon in der frühen
E. M. vorhanden waren und die Musique Concrète aus technischer
Sicht nur weitere "Wellenformen" beisteuerte, wurde das Ganze weiterhin
durchaus logisch als E. M. bezeichnet.
Durch diese Absorption bis ca. 1960 wurde der radikale Ansatz
aus Köln also keineswegs verwässert, es änderte sich
nichts an der Situationseinschätzung der stagnierenden Musik und
auch nichts am Versuch, dem zu entkommen: "Darf ich Sie bitten, sich
einmal einen Maler vorzustellen, der in folgender Weise an die
Ausführung eines Gemäldes geht. Fertigt Malplan an. Stellt
eine Reihe von Mahlgehilfen an, für gelb, rot und blau.
Planquadrate unter Leitung eines Obermalgehilfen ausfüllen. Wenn
einer besonders in Schwung ist, malt er ein bißchen anders. Er
"interpretiert" dann. Groteske Vorstellung. Entspricht aber völlig
dem Verfahren, das bei Konzertaufführungen geübt wird.
Komponist tritt weitgehend in den Hintergrund. Wie kann man ihn in den
Vordergrund holen? Ist es nicht möglich, ohne den Umweg über
den "Musikhandwerker" (Schönberg) gehen zu müssen, gleich in
Klängen zu komponieren, statt auf dem Papier?" [3].
Die heute zur Verfügung stehenden technischen Verfahren
gehen natürlich weit über das Arsenal von 1949 hinaus, meist
aber nicht über das damals mathematisch-theoretisch Bekannte.
Besonders die diskrete, zahlenbasierte Verarbeitung von Audiomaterial
(vulgo "digital") hat noch gar nicht absehbare Möglichkeiten
geschaffen. Denn es kann jede Zahlenmanipulation, die sich als
Algorithmus ausdenken und aufschreiben läßt, sofort auch als
Audio-Ereignis realisiert werden. Solche Programme kann im Prinzip
jeder recht einfach erstellen. Was im analogen Bereich unrealisierbar
war (Fehlerfortpflanzung, Drift), kann nun ohne weiteres
durchgeführt werden. Die Mathematik der letzten drei Jahrhunderte
kann nun zu musikalischen Zwecken herangezogen werden, dies wird ganz
neue Größenordnungen der Komplexität erlauben. Die
Begrenzung liegt demnach nicht mehr im Materiellen. Die Begrenzung
liegt in der Intuition, im Verstand und in der Bildung des Menschen.
Busonis Ketten sind insofern in der E. M. völlig abgefallen.
Dieser technische Fortschritt ändert natürlich gar
nichts an den Feststellungen, die in historischer Konsequenz zur E. M.
geführt haben. E. M. entsteht nicht einfach durch das Einschalten
von elektronischen Apparaten, vielmehr steht dahinter eine historische
Entwicklung nebst den radikalen Folgerungen daraus:
1. E. M. ist authentisch: E. M. ist die einzige authentische
Musik, da der Komponist das akustische Endergebnis in extrem
weitgehender Weise selbst definiert und freigibt. Die interpretierende
Musik "klassischer" Werke dagegen ist auf Vermutungen über die
akustisch beabsichtigte Ausführung angewiesen, wenn der Komponist
nicht zugegen ist. Dies fängt bei Tempo und Dynamik an und endet
bei Eingriffen in den Notentext. Selbst wenn der Komponist zugegen ist,
kann es durch die Mängel des Orchesterapparates zu anderen als den
beabsichtigten Klangereignissen kommen.
2. E. M. ist autonom: E. M. braucht keinen Interpreten, sie
kommt vom Klangspeicher über Lautsprecher direkt zum Hörer.
Damit ist E. M. also auch autonom, nicht geschmäcklerischen
Variationen durch Dirigent, Musikanten usw. unterworfen. Der Komponist
der E. M. braucht nicht nach Orchestern suchen, die vielleicht bereit
sind, seine Kompositionen zu spielen. Wegen der erkannten Mängel
grenzt sich die E. M. radikal gegen die mechanische Instrumentalmusik
und gegen die Vokalmusik ab.
3. E. M. braucht die alten Vereinbarungen nicht mehr: Das
Fehlen des menschlichen Interpreten ermöglicht es auch, die auf
dessen praktische Erfordernis ausgerichteten Vereinbarungen fallen zu
lassen. Das alte Koordinatensystem von Harmonik, Melodik und Rhythmik
als Orientierungshilfe des Interpreten ist fortan nur noch
unnötige Selbstbeschränkung. Es ist sogar möglichst
vollständig zu meiden, da man durch die immer vorhandene
Trägheit des Geistes ohnehin ungewollt am Gewohnten kleben bleiben
wird.
4. E. M. kann den Raum nutzen: Die Bühne bleibt bei E. M.
leer, es findet keine Zirkusnummer mehr statt. Daher wird der gesamte
Raum als Dimension der Komposition oder der Struktur nutzbar. Es ist
Platz für den Raum und die Raumwirkung. Dieser Einfluß auf
den Klang kann durch entsprechende mehrkanalige Lautsprecheraufstellung
als kompositorisches Mittel genutzt werden. Die Zuhörer
müssen nicht nach vorne ausgerichtet sitzen, sie müssen
vielleicht überhaupt nicht stillsitzen. Die Bühne bleibt
leer, die E. M. verlangt deshalb nach neuen Aufführungsformen.
5. E. M. ist nicht "live": Die E. M. nutzt die neuen
technischen Möglichkeiten, um das Primat der Zeit zu durchbrechen.
Sie ist genau deshalb nicht Echtzeitkunst. Die bildende Kunst ist die
Kunst der drei Raumdimensionen. Die E. M. ist die Kunst der
Zeitdimension, sie geschieht nicht in der Zeit, sondern formt mit der
Zeit. Man hat Ruhe, die Dinge im Studio zu bereiten und sich entwickeln
zu lassen. Dies eröffnet ganz neue Größenordnungen der
Komplexität. Die E. M. wird genau deswegen im Studio vorproduziert
und über Lautsprecher wiedergegeben. Die traditionelle
Musikausübung ist dagegen immer in Echtzeit, abhängig von der
Zeit, also "live", der Komplexitätsgrad ist damit sehr
beschränkt.
6. E. M. kann den Klang nutzen: Die besondere Eigenschaft der
E. M. ist es, den Klang weitestgehend zu formen, ja aus dem Nichts
erschaffen zu können, daher wird der Klang gegenüber den
traditionellen Strukturelementen gleichwertiges Mittel und sogar
hervorgehoben. Es findet auch damit eine gewisse Annäherung an die
bildende Kunst statt. Der Klang wird somit zum ersten Mal in der
Geschichte zu einer Dimension kompositorischen Schaffens. Dies ist mit
mechanischen Instrumenten unmöglich, wohl deshalb spielt Klang in
der herkömmlichen Musikausübung eine sehr untergeordnete
Rolle, es gibt noch nicht einmal Symbole dafür in der klassischen
Notenschrift, Kompositionen wurden und werden ohne weiteres
uminstrumentiert. "Im Gegensatz zu allen "mechanischen
Musikinstrumenten" ... verfügen die elektronischen Instrumente
über eine in keiner Dimensionalität ernsthaft
eingeschränkte Klang- oder Geräuschpalette. Ihnen ist der
volle Bereich vom realistischen Meeresrauschen und der täuschenden
Imitation traditioneller Orchesterinstrumente bis zur stilisierten
Sprache und den mit Worten nicht beschreibbaren Klängen einer
irrationalen Sphäre zugänglich. Sinnlicher Reiz steht neben
äußerster Askese und psychischer Aggressivität" [3].
7. E. M. spricht die gesamten natürlichen
Fähigkeiten des Menschen an: Das menschliche Ohr kann wesentlich
mehr erfassen, als Instrumentalisten jemals zu spielen im Stande sind
und als das herkömmliche System zu bieten hat, wenn nicht
jahrelanger Drill diese Gabe endlich ausradiert hat. Die übliche
Vorgehensweise mit Musikern verlangt aus praktischen Gründen nach
einem simplen System. Die Beschränkung der vorherrschenden Praxis
ist insofern unmenschlich, als das sie dem Menschen als Hörer
nicht gerecht wird. Diese Erkenntnis ebnet neuen Kompositionssystemen
und freier Klangmalerei den Weg. Wo das alte System fehlt - z. B. in
der sog. "Neuen Musik" -, muß dem Menschen als Spieler oft per
Kopfhörer ein Metrum oder sonstiger Anhaltspunkt vorgegeben
werden, der Instrumentalist hängt also am Tropf der Maschine. Dies
ist wiederum unmenschlich.
Das wäre in sieben Artikeln eine aus der Geschichte
erwachsene Definition der Elektronischen Musik, die Meyer-Eppler in den
wesentlichen Zügen schon seit 1949 vehement vertreten hat.
(Nebenbei: haben Sie schon bemerkt, daß Meyer-Epplers Initialen
umgedreht E. M. ergeben?) Da hier einmal grundlegend nachgedacht wurde,
haben die Überlegungen und deren Resultate immer noch Bestand. Es
gibt also keinerlei innermusikalisches Motiv, hier grundsätzlich
zu ändern. Die außermusikalischen Motive untersuche ich
weiter unten.
Computer
Eine weitere Verwirrung kam mit der Bezeichnung
"Computermusik" auf. Das Wörterbuch sagt: engl. techn. computer:
die Rechenanlage, der Rechenautomat. Computer sind rein elektronische
Apparate mit etwas Mechanik bei der Festplatte und den Lüftern.
Was viele nicht wissen: vor den Microcomputern gab es auch schon
Computer als rein analog-elektronische oder sogar analog-
mechanische Geräte, die z. B. Differentialgleichungen lösen
konnten. Analog, wie einst alle Komponenten des elektronischen Studios.
Der Übergang war fließend, die Modularen Synthesizer z. B.
stammen davon ab, alter Wein in neuen Schläuchen.
Nur zu oft bleiben die heutigen Algorithmen sogar auf dem
Stand dieser analogen Techniken stehen, besser gesagt: sie versuchen,
diese möglichst nachzuahmen, man ist noch mit der Aufarbeitung des
Gewesenen beschäftigt. Klanglich scheitert dies
regelmäßig, weil immer noch nicht theoretisch erfaßt
ist, wodurch sich der nichtlinear dominierte Klang alter analoger
Technik ausbildet, was daran wesentlich und was verzichtbar ist. Vor
allem Rückkopplungsschleifen mit Nichtlinearitäten machen
hierbei große Probleme. Trotzdem hat auch mathematisch gesehen
durch den Einsatz des Computers bei der Klangerzeugung prinzipiell nur
ein Übergang von nichtlinearen Differentialgleichungen auf lineare
oder nichtlineare Differenzengleichungen stattgefunden, der Unterschied
wird mit steigender Abtastrate beliebig klein.
Rechtfertigen läßt sich dieser neue Begriff
"Computermusik" daher nur für einen nicht ganz neuen und anderen
Sachverhalt: daß Kompositionen - durchaus auch herkömmlicher
Art - durch algorithmische Berechnung und somit bequemerweise durch
Computer zur Partitur gebracht werden, sei es durch
Kompositionsprogramme, reine Noteneditoren oder Midi-Sequenzer,
letztere können das Ergebnis dann auch gleich noch zu Gehör
bringen. Die Illiac Suite für Streichquartett von 1957 wird als
erste vom Computer komponierte Musik angesehen. Tonsatz erfolgt nach
Regeln, also Algorithmen, diese kann man programmieren und damit
korrekt gesetzte Musik vom Rechner erzeugen lassen. Dies Handwerkliche
kann der Automat auf jeden Fall übernehmen, es braucht dazu keine
menschliche "Inspiration". Erste Ansätze zur algorithmischen
Komposition gibt es schon seit der Renaissance und W. A. Mozart selbst
erfand ein "musikalisches Würfelspiel".
Was aber, wenn der Computer ein Stück nach Art der Wiener
Klassik komponiert und selbst Experten auf diese Fälschung
hereinfallen? Man glaubte schließlich auch einmal, daß der
Computer niemals Schachgroßmeister schlagen könne, da es ihm
ja völlig an Intuition und an Einsicht mangele. Ist das dann
Computermusik oder Klassik? Hier sollte man wohl besser das Ergebnis
betrachten und nicht den Weg. Durch Einschalten eines Computers
entsteht also nicht notwendigerweise Computermusik.
Die eigentliche Klangerzeugung oder Synthese ist weiterhin
elektronisch und konzeptionell meist noch nicht einmal neu. Ob nun der
Computer die Frequenzmodulation ausrechnet, oder dies mit analogen
Mitteln geschieht, ob der Computer Audio-Schnipsel (Samples) speichert
und manipuliert, oder ob dies per Magnetband oder Eimerkettenspeicher
erfolgt, ist prinzipiell egal. Der Rechner ist nur ein modernes
Werkzeug das uns die Mühsal von Bandschnitten mit der
Schneidklebevorrichtung und das Ausrechnen von Reihen erspart. Ein
neues Wort ist also dafür weder nötig noch hilfreich, das ist
weiterhin der Bereich der E. M.
Bei der Analyse von Audiomaterial wird allerdings bei den
neueren Methoden mit Hilfe des Rechners eine Komplexität erreicht,
die von mechanischen oder analog-elektronischen Mitteln (schon da gab
es Fourier-Analysatoren) auch nicht ansatzweise geleistet wurde.
Allerdings ist dann der Ausdruck "Computermusik" sehr unspezifisch, man
sollte dann die jeweilige Analysemethode in den Vordergrund der
Bezeichnung stellen.
Ignoranz
Die Kritiker waren mit der E. M. überfordert und
sprachlos, da das alte Werte- und Ordnungsschema auf diese Musik nicht
mehr anwendbar war. Es blieb meist nur Humoristisches oder
Gekläff. Ein Beispiel sei hier zitiert, der Vortrag "Was ist
Musik?": "Ausschlaggebend scheint mir, daß hier Dinge produziert
werden, die für uns gar nicht apperzipierbar sind, weil unser
Gehör, das auf den Naturklang und seine Ableitungen eingerichtet
ist, weder im physischen noch im psychischen Sinne befähigt ist,
diese Produktionen zu verarbeiten, und beim Versuch zur Apperzeption
vergeblich nach Beziehungen zum naturklanglichen Tonstoff sucht, der in
den elektronischen Reizen nicht mehr enthalten ist. Darüber hinaus
muß ich bekennen, daß ich nicht sicher bin, ob es
überhaupt genügt, diese Experimente von einem nur
musikalischen Standpunkt zu beurteilen, und ob hier nicht
übergeordnete ethische Probleme angerührt werden. Ist es
statthaft, daß wir die Axt an die Wurzeln einer der
vollkommensten Schöpfungen Gottes legen, um dann aus den
Trümmern eine Fratzenwelt aufzubauen, die den Schöpfer
äfft? Ist das nicht Vermessenheit? Streift es nicht an Blasphemie?
Es mag wohl sein, daß diese nur durch Apparate produzierbare und
reproduzierbare Schallgeneration etwas ist, was unser Zeitalter der
Atomzertrümmerung und der Vollautomation spiegelt. Mit Musik aber
hat dieses volldenaturierte Produkt aus der Montage physikalischer
Schälle nichts mehr zu tun. Hier ist die Grenze entschieden
überschritten" [6]. Markige Worte, die zwar als "Kasseler Axt" in
die Geschichte eingingen, aber auch ebenso deutlich die
Beschränktheit ihres Verfassers darlegen. Was ist denn z. B. der
"Naturklang"? Doch nicht etwa der Klang eines Konzertflügels, also
einer mechanischen High-Tech-Maschine? Der pseudowissenschaftliche
Rückgriff auf die angeblichen Eigenschaften des menschlichen
Gehörs dürfte die Elektroniker der Zeit zum Lachen gebracht
haben, denn diese kannten die tatsächlichen Möglichkeiten aus
eigener Erfahrung.
Die Musik scheint oft nur mit sich selbst beschäftigt, es
wird zu viel Zeit mit mechanischem Drill verbracht.
Interdisziplinäres findet gar nicht oder kaum statt, man hat
dafür schlicht keine Zeit. "Musiker" ist eben für viele ein
knallharter Hochleistungsberuf, dem Profisport in vielen Dingen sehr
ähnlich, auch in den ethischen Fragen und Problemen.
Das Buch von Truax [9] belegt, daß sich bereits etwas
verändert hat. Die Einordnung "physikalischer Schälle" hat
sich gewandelt, die Definition von Musik ganz wesentlich erweitert.
Denn Truax benutzt seine Ohren zum hinhören, anstatt zum
Wiedererkennen des Bekannten. Das ist das Hervorragende an diesem Buch.
Es ist aber - wie oben gezeigt - auch ein Beleg für Nichtwissen
aus heutiger Zeit. Truax ist schließlich nicht irgendwer, sondern
preisgekrönte und bekannte Persönlichkeit der
"elektroakustischen Szene". Truax rangiert dabei durchaus noch im
Mittelfeld, denn es geht noch schlimmer, noch ahnungsloser, in [10]
findet man: "Die neue
Wettbewerbskategorie "Elektronische Musik" sorgte für Aufsehen bei
"Jugend musiziert" ... ich wurde eingeladen, beim diesjährigen
Bundeswettbewerb Mitglied der Jury zu sein ... Sie reichte von
Kompositionen der Erfinder dieser Gattung Cage und Maderna ... was
meint: Akkordeonsolo und Flötensolo mit Elektronik .... Nicht
daran zu denken, dass durch die erweiterten Instrumentarien die
notwendigen "konservativen" Qualitäten zu leiden gehabt
hätten. Intonation, Agogik, Zusammenspiel und Präzision,
Dynamik et cetera wurden streng beachtet und bezeugten eine
sorgfältige Vorbereitung und Hingabe an die Aufgabe". Cage
und Maderna haben demnach die E. M. erfunden, und diese wird mit
Akkordeon und Flöte gemacht. Dies äußert nicht etwa ein
pisa-geschädigtes Schulmädchen, sondern eine Professorin und
Jury-Mitglied bei "Jugend Musiziert, Wettbewerbskategorie Elektronische
Musik" in der "Neuen Musikzeitung". Hierzu fällt mir nichts
druckbares mehr ein.
Damit komme ich zu einer wichtigen Ursache des
Nichtwissenwollens, der Ignoranz, auch in der Auffassung und Aufnahme
der E. M. Sie wird mit verursacht durch die tiefe Spaltung in "zwei
Kulturen", wie der Physiker und Schriftsteller Charles Percy Snow es
nannte. Die erste literarische und geisteswissenschaftliche - und ich
füge hinzu künstlerische und musikalische - Kultur, sowie auf
der anderen Seite die zweite Kultur der Naturwissenschaften und
Technik.
Snow ereiferte sich in seinem Vortrag 1959 zu Recht über
die hochnäsige Unwissenheit der ersten gegenüber der zweiten
Kultur, den Stolz, rein gar nichts über sie zu wissen, sie damit
als unwichtig abzustempeln. Noch 1999 gab es Literaten wie Dietrich
Schwanitz, die solche Einfalt allen Ernstes als "gebildet" empfanden
und dies in einem Kassenschlager ausbreiteten und damit weiterer
Zementierung Vorschub leisteten ("Bildung - alles was man wissen
muß". und vor allem darin "Was man nicht wissen sollte"). Die
Motive, die diese Einstellung hervorrufen sind sicherlich
vielfältig, drei liegen aber auf der Hand:
Es besteht eine merkwürdige Ansicht der Geschichte, die
die sieben (gelegentlich auch neun, die Anzahl wechselt) Künste
des freien Mannes der Antike (Grammatik, Dialektik, Rhetorik,
Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik) auf die
nicht-naturwissenschaftlich-mathematischen vier zurückstutzt.
Somit wird die einstmalige Einheit dieser Künste - wichtig: unter
Einbeziehung der Musik! - , geleugnet. Pythagoras untersuchte die
Zahlen, aber auch die Töne.
Der (zumindest vordergründig) enorme Erfolg und immer
noch exponentielle Aufschwung von Naturwissenschaft und Technik
muß spätestens seit Newtons "Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica" Gefühle der Mißgunst erwecken, indem
durch wenige Prinzipien das auf einfache und überzeugende Weise
erklärbar und berechenbar wurde, was vorher durch 6000 Jahre
Spekulation und Deduktion unerklärt und unberechenbar blieb: z. B.
die scheinbare Bewegung der Gestirne am Himmel.
Schlimmer noch: der Emporkömmling war nicht nur für
jeden sichtbar erfolgreich, sondern brachte zugleich eine neue Kultur
mit einer eigenen Sprache - die der Mathematik - hervor, die
tatsächlich auf der ganzen Welt unabhängig von der
natürlichen Sprache und Kultur verstanden werden kann. Hier
entstand eine neue, tatsächlich kulturübergreifende
Universalität, die die erste Kultur - sie ist nur auf einen
Kulturraum beschränkt - niemals erreichen konnte. Die knappe aber
um so exaktere Sprache der Mathematik wirkt auf einseitig Ausgebildete
der ersten Kultur gleichzeitig als total ausschließend.
Die erste Kultur findet sich somit von einer zweiten
universalen Weltkultur in gewisser Weise überflügelt und
gleichzeitig ausgeschlossen. Man straft das Ganze am besten durch
Nichthinsehen. Dabei will man auf die offensichtlichen Vorteile des
Verachteten natürlich keinesfalls verzichten: Klimaanlagen,
Zentralheizung, sauberes Wasser, Medizin, Fortbewegungsmittel, Radio,
Fernsehen, Internet, usw. Diese somit scheinheilige Ablehnung hat
natürlich Verärgerung auf Seiten der zweiten Kultur
hervorgerufen, wo nun im Gegenzug Literatur, Kunst, Philologie usw. als
"zweifelhaft", "unwissenschaftlich", "unlogisch" und "irrelevant"
eingestuft wurden. Inzwischen sind fast 50 Jahre vergangen und heute
ist ein solcher Standpunkt der gegenseitigen Ignoranz und Polemik
seltener zu finden. Die bildende Kunst setzt sich seit langem mit
Naturwissenschaft und Technik kritisch auseinander, dazu gehört
auch, daß man etwas von diesem Gegenstand versteht. Das Eis
schmilzt, man geht aufeinander zu, jeder weiß: es geht auf beiden
Seiten nicht ohne die andere.
Es gibt aber eine bemerkenswerte Ausnahme: die Musik hält
sich abseits, hält am unbedingten Primat der ersten Kultur fest,
will sich nicht von Naturwissenschaft und Technik in die Karten sehen
lassen. Das Selbstbild, das in allen anderen Disziplinen durch
Naturwissenschaft und Technik ziemlich gerupft wurde, könnte ja
Schaden nehmen. Aber es ist ja bereits geschehen, denn
zeitgenössische Nachschlagewerke definieren sehr weit: "Musik ist
die in irgendeiner Form von Menschen geplante Ausstrahlung von
Schallwellen". Engere Definitionen führen schnell zu logischen
Schwierigkeiten und Chauvinismus.
Zur Musik bedarf es immer einer "Technik", vom hohlen
Baumstamm bis zum Mikrochip. Und das Wort "Musik" selbst stammt von
griech. "musike techne", der "Kunst der Musen", griech: "technos"
bedeutet Künstler oder Handwerker. Muse und Technik, nur beides
zusammen machte den Begriff "Musik" im ursprünglichen Sinne aus.
Die Horde mit Stammesführern als soziale Struktur gibt es
auch in den anderen Künsten. Es ist jedoch bemerkenswert,
daß z. B. in der Physik ein unbekannter Patentbeamter dritter
Klasse (Albert Einstein) in nur wenigen Jahrzehnten trotz zum Teil
heftiger Gegenwehr das Weltbild kippen konnte und 30 Jahre später
- als er dann selbst ein Häuptling war - wiederum andere Neuerer
(z. B. Nils Bohr und seine Schüler) ihn übertrumpften. Auch
in der Mathematik kommen wichtige Beiträge von vorher völlig
Unbekannten. Was wird gesagt und warum darf man es behaupten, das sind
die entscheidenden Fragen, die zur Bewertung führen, erst dann
kommt: wer hat es gesagt. Meinungsführer müssen sich dem
strengen oder empirischen Beweis beugen.
In der Musik ist es dagegen noch oft wie in der Theologie,
erst das wer, dann das was, dann vielleicht noch das warum,
Autoritäten und Dogmen, das geht hin bis zum absurden Personenkult
des Genies und der Virtuosen. J. S. Bach wäre darüber
entsetzt, er wußte sehr selbstbewußt seine Kräfte
einzuschätzen, betrachtete sein Werk aber als ehrliches Handwerk,
nicht mehr und nicht weniger. Wo es Dogmen gibt, so gibt es auch den
Bannfluch: Herbert Eimert wurde aus dem Konservatorium hinausgeworfen,
weil er eine Schrift zur Zwölftonmusik erstellt hatte (Atonale
Musiklehre, 1923).
Ein Blick in ein Musiklexikon [11] zeigt: Sachartikel nehmen
nur erschreckend geringen Raum ein, dafür findet man z. T.
völlig unwichtige Personalia zu Hauf, nach Stichproben machen sie
etwa die Hälfte der Einträge aus. Kennen Sie "Cindy und
Bert"? Die E. M. als wichtigste Neuerung des 20. Jahrhunderts muß
sich mit drei Spalten der knapp 700 Seiten begnügen, ihre
Geschichte und die Ziele fehlen völlig, der Leser bleibt damit
genauso ahnungslos wie die Autoren des Eintrages selbst. Die
Protagonisten der E. M. fehlen nur zum Teil. Eimert hat wegen dieser
Tendenzen selbst in Schrift und Tonträgern mustergültig
vorgesorgt [4], [7], man konnte ihn daher nicht ignorieren, aber
Meyer-Eppler fehlt. Zumindestens ist die musikwissenschaftliche
Aufarbeitung und Sicherung seiner Arbeit geschehen [3]. Beyer verfolgte
die Idee der "freien Klangfarbenmalerei", es kam daher zur Trennung von
Häuptling Eimert und dem Studio. Bei so etwas ist man bereits zu
Lebzeiten "gestorben", also sucht man ihn trotz einiger Werke im
Musiklexikon vergebens. Sein Erbe ist zerstreut, nach meinen
Erkundigungen bei der Stadt Düsseldorf bestehen da nur sehr
geringe Hoffnungen einer Aufarbeitung. Beyer hat vielleicht keine
wichtigen Schriften hinterlassen, aber möglicherweise existieren
noch Tondokumente dieser Ideen, die bis heute (in Gegensatz zu den von
Eimert verfolgten) Bestand haben. Pierre Schaeffer vertrat
ähnliche Auffassungen, sein Werk besteht aber in einer eigenen
Institution fort (GRM, Groupe de Recherches Musicales, Paris), das
Lexikon hat immerhin einen Vierzeiler für ihn übrig.
Kunstmusik ist immer ein Verlustgeschäft, nur
Wohlverhalten eröffnet Positionen und Gehälter, denn der
Musiker lebt nicht vom Klang allein. Der Schüler muß sich
schon deswegen dem Meister unterwerfen, Buckeln statt Aufstand. Die
Fähigkeit zur Generalreform und Revision scheint der Musik damit
abhanden gekommen zu sein, die ewig Gestrigen wirken noch über den
Tod hinaus. Ein Wesensmerkmal der heutigen Musik ist daher ihre fast
vollständige Ausrichtung auf die Vergangenheit, im krassen
Gegensatz zu allen anderen Künsten. Zwar haben die
Musikhochschulen Lehrstühle für Neue Musik, und sogar E. M.
und es gibt einige vorwärts gerichtete Vorlesungen, aber in den
Lehrplänen der verschiedenen Ausbildungsgänge tauchen diese
nicht auf. Nur in einem von etwa zehn Fächern - der
Musikwissenschaft - könnte vielleicht eine Auseinandersetzung mit
der Gegenwart erfolgen. Alles andere ist mechanisches Training und
Geschichte.
Das hat Auswirkungen bis in die Spielpläne. Seit einiger
Zeit ist die Freiburger Konzerthalle erfreulich progressiv
ausgerichtet, ein neuer Intendant hat sich gegen alle Widerstände
durchgesetzt. Ein Blick in den Plan der ersten Jahreshälfte 2005
zeigt: es werden etwa 83 Werke dargeboten, ca. 8% sind etwa 300 Jahre
alt, 24% 200 Jahre, 18% 150 Jahre, 23% 100 Jahre, 17% 50 Jahre und
immerhin noch 10% gehören der unmittelbaren Vergangenheit an, es
gibt sogar eine Uraufführung. Das muß man wirklich loben, es
ist nicht selbstverständlich. Trotzdem sind drei Viertel aller
Werke älter als 100 Jahre, die Hälfte älter als 150
Jahre! Auch darüber wäre Bach entsetzt, bis vor etwa hundert
Jahren wurde selbstverständlich aktuell Komponiertes
aufgeführt. Die Mäzene und das Publikum forderten stets
vehement das Neue. Die komplexe Musik war nie eine Musik der Masse,
sondern eine der Elite. Die seit etwa achtzig Jahren stattfindende
Konzentration auf längst Vergangenes wird auch noch diese Wenigen
vorbeiziehen lassen. Der Konzertsaal als Museum alter Musik
läßt jeden Bezug zur Gegenwart vermissen. So wird es immer
schwieriger, die Geldgeber der Jetztzeit für weitere Ausgaben zu
gewinnen. Das Orchestersterben ist nicht nur eine Finanzkrise.
Die bisherige Musikausübung ist als das zu sehen, was sie
ist: kulturelles Artefakt, kulturelle Vereinbarung und kulturelle
Auslese, damit stets zur Debatte stehend und keinesfalls natur- oder
gottgegeben. In Äußerungen wie der "Kasseler Axt" und den
anderen Beispielen haben Vorurteile, Unwissenheit, soziale und
wirtschaftliche Aspekte und der genannte Kampf der Kulturen die
entscheidende Rolle inne.
Die Folgen
Die herkömmliche musikalische Ausbildung ist für E.
M. nicht besonders nützlich. Mit ihrer völligen
Vernachlässigung des Klanges, ihrer Ausschließlichkeit nur
eines bestimmten, im wesentlichen ca. 2500 Jahre alten Systems und
ihrer mangelnden Vermittlung der tatsächlichen Grundlagen - des
"Warum?" - ist sie vielleicht sogar schädlich. Dies mag mit ein
Grund für die Abkehr vieler Komponisten von der E. M. gewesen
sein, die man seit 1960 beobachtet. Ein anderer Grund besteht in dem o.
g. wirtschaftlichen Zwang, denn es ist klar, daß ein solch
radikaler Ansatz wie derjenige der E. M. nicht zur kommerziellen
Auswertung taugt. Vielleicht fehlte es auch an Geduld, denn die Technik
von 1960 mußte erst reifen, es war fast noch zu früh. Wie
auch immer, man überließ das Feld anderen.
Die Simpel-Musik-Szene schlachtete die neuen Erfindungen seit
etwa 1968 gnadenlos aus, um mit ständig neuen Klangreizen ihre
totale - an Schwachsinn grenzende - kompositorische Armut
notdürftig zu übertünchen. Oh Baby balla balla... Ein
durchaus gelungener, kaufmännischer Vermarktungsansatz, der bis
heute funktioniert und automatisch vom technischen Fortschritt gespeist
wird. Haben Sie Stockhausen auf der Hülle des Sgt. Pepper Albums
erkannt? Die Beatles wußten immerhin noch, woher diese Techniken
eigentlich kamen.
Es ist leider so: die modernen Mittel der elektronischen
Technik werden in viel größerem Umfang und von dafür
viel besser ausgebildeten Musikern in der Pop-Musik eingesetzt, als
dies auf Seite der Kunst-Musik jemals der Fall wäre. Ein Vorteil
dieser Entwicklung ist es, daß elektronische Apparate in
großer Menge, immer preiswerter und leistungsfähiger
für jedermann auf dem Markt sind, wenn auch die Technologie immer
zehn Jahre oder mehr hinter dem Stand von Forschung und Technik
hinterherhinkt und oft die Möglichkeiten durch den vorgesehenen
Simpel-Musik-Einsatzzweck stark eingeschränkt sind.
Elektronische Klänge sind heute überall, in jedem
Film, in jeder Werbung spielen sie eine Rolle. Die Allgemeinheit hat
sich so daran gewöhnt, daß die Allgegenwart elektronischer
Hintergrundbeschallung niemandem mehr auffällt. Dies ist
nützlich, da diese Klänge heute nicht mehr erschreckend auf
die Menschen wirken. Und es ist zugleich schädlich, weil
elektronischen Klängen ein Plastikimage des Billigen anhaftet.
Diese enorme Massenwirkung führt natürlich zur totalen
Verwirrung über den Begriff der E. M., elektronisch produzierte
Simpel-Musik wird deswegen sehr oft naiv der E. M. gleichgesetzt.
Truax spricht in [9] von der Dominanz einer bestimmten Musik,
die natürlich tiefgreifende Folgen auf den musikalischen Horizont
der allgemeinen Hörerschaft haben muß. Gemeint ist die
Pop-Musik mit vorwiegend amerikanisch-folkloristischen Einflüssen.
Eine Monokultur macht sich seit mehr als 50 Jahren in den Köpfen
breit, die jede andere Erfahrung von vorne herein unmöglich macht.
Wer schon als Kind nur "Pommes-rot-weiß", "Curry-Wurst" und
"Hamburger" kennengelernt hat, der dürfte als Erwachsener einige
Schwierigkeiten haben, ein auch nur etwas hochwertigeres Menü zu
genießen.
Es kam als mißlungener Abgrenzungsversuch der Kunstmusik
auf diese z. T. selbstverschuldete Entgleisung der Elektronik zur
"elektroakustischen Musik", einer unglücklichen und doppelt
unsinnigen Wortschöpfung. Denn zum einen ist Musik immer akustisch
(sonst hört man nichts [8], s. o. Anmerkungen zur Mechanik und
Akustik), zum anderen wird jede Musik, und gerade die "schlimme"
Simpel-Musik durch die elektroakustische Verwertungskette
transportiert, womit der Versuch der Absonderung vom Trivialen logisch
völlig scheitert. In [4] sieht man das ebenso kritisch, in [5]
gibt es noch nicht einmal einen Eintrag "elektroakustische Musik".
Gemeint war mit "elektroakustisch" wohl: "akustisch wertvolle
Musik", die "Miteinbeziehung von Instrumentalisten mit ihren
mechanischen Instrumenten" - die von dieser Seite ja immer noch
hartnäckig als "akustische Instrumente" bezeichnet werden - , der
"Rückgriff auf wertvolle Tradition". In der Praxis bekommt man
fast ausschließlich die "drei Klarinetten mit ganz leisem
Zuspielband" serviert, nicht selten garniert mit ernsthaften Zweifeln
an der elektronisch-technischen Kompetenz des Komponisten und der
Aufführenden. In vielen Beispielen der "elektroakustischen Musik"
ist die Elektronik nur unwichtiges und banales Beiwerk. Dahinter steht
auch: man traut sich und seiner Musik nicht zu, ohne
Bühnenpräsenz auszukommen. Etwas zu gaffen ist offenbar
wichtig, man akzeptiert dann lieber weiterhin an die Busonische Kette
gelegt zu werden. Man weiß nicht, was man dadurch an Freiheit
verliert, da man das Potential der E. M nie wirklich verstanden hat.
Das muß ich jedenfalls aus vielen "elektro-akustischen"
Produktionen schließen.
Das Weglassen der mechanischen Instrumente ist nicht besonders
sozialverträglich, vorhandene Musiker klagen Beschäftigung
ein und sind über diese "neuen" Entwicklungen nur selten
begeistert. Wenn man jahrzehntelang am Instrument trainiert hat, ja
sein Leben darauf ausgerichtet hat, dann ist eine Musik ohne
mechanische Instrumente wohl kaum zu akzeptieren. Wer sich immer noch
mit E. M. abgibt, der lebt gefährlich, besonders in Akademia. Der
"Elektroniker" wird die Ablehnung der "Mechaniker" zu spüren
bekommen, und die haben das Sagen. Wer über E. M. promoviert, hat
Schwierigkeiten, einen Prüfer zu finden. E. M. an der
Musikhochschule trifft nicht gerade auf begeisterte Resonanz und E. M.
im Radio findet auch heute noch nur im Nachtprogramm statt, im
Fernsehen ist sie noch nicht einmal im Kulturkanal vorhanden. Die
Häuptlinge sind nicht begeistert und das Interdikt des jeweiligen
Papstes droht, die Auseinandersetzung hat tatsächlich etwas
religiöses an sich. Das sind und waren existentielle Gründe,
um zurückzurudern, zurück von der klaren Analyse der E. M.
zum faulen Kompromiß der "elektroakustischen Musik".
Schluß
Es bleibt also für unsere Arbeit beim Begriff
"Elektronische Musik" mit großem "E" als Gattungsbegriff.
Für uns ist sie die z. Z. einzig denkbare Alternative zur endlosen
Wiederholung des Bekannten, des wertvollen Gewesenen, oder des zu
simplen Neuen. Denn die "Neue-Musik" erscheint ausgereizt, sie ist
sogar schon bis hin zur Zerstörung der Instrumente vor Publikum
gekommen. Computermusik findet man bei ZeM-Veranstaltungen zuweilen bei
kompositorischen Bearbeitungen klassischer Musik, mit denen oft der
Bezug zur Vergangenheit hergestellt werden kann, ich habe dies z. B.
mit meinen "12 Variationen" getan.
Aus der immer noch gültigen historischen Konsequenz
heraus findet E. M. gerade nicht "live" statt und nicht mit
Einbeziehung mechanischer Instrumente, sie braucht den Interpreten
nicht und damit auch nicht das vorherrschende Ordnungssystem, sie ist
insofern völlig frei. Sie ist als einzige Musikform autonom und
über die Zeit authentisch. Sie ist somit die radikalste Neuerung
in 2500 Jahren Musikgeschichte, wahrlich die Axt am Stamm des
Überkommenen.
Es verwundert bei den sozialen und wirtschaftlichen
Zwängen nicht, daß heute nur ganz wenige echte E. M.
produzieren, meist sogar unter der Bezeichnung "elektroakustisch".
Einstige Protagonisten sind sogar zu Opern zurückgekehrt. Dies
kann uns nur recht sein, sind wir doch somit wahrscheinlich die einzige
Vereinigung für E. M. in Deutschland und vielleicht darüber
hinaus, die die obige Situationsanalyse, Begründung und Definition
der E. M. ernst nimmt und auch tatsächlich umzusetzen versucht.
Wir in ZeM können uns das leisten, denn Musik ist nicht unser
Brotberuf. Ob uns das künstlerisch immer gelingt und ob das
Ergebnis "schön" ist, sind ganz andere Fragen. Ein kompletter
Neuanfang ist keine einfache Sache. Man begibt sich dabei in Gefahr,
denn die mögliche Fallhöhe wird deutlich größer.
Diese Spannung ist aber wesentlich besser, als die Langeweile der
ewigen Wiederholungen.
Quellen
[1] Die Zeit, 11.03.2004, Nr. 12, Feuilleton
[2] Ferruccio Busoni: "Entwurf einer neuen Ästhetik ...", Insel
Verlag, 1916
[3] Elena Ungeheuer, "Wie die elektronische Musik erfunden wurde",
Quellenstudie zu Werner Meyer- Epplers musikalischem Entwurf..., Schott
Verlag
[4] Eimert, Humpert, "Das Lexikon der elektronischen Musik", Bosse
Verlag, 1973
[5] Brockhaus Lexikon, unter "elektronischer Musik", jede Auflage ab
1956
[6] Friedrich Blume, "Was ist Musik?", Vortrag in Kassel 1959, in [3]
[7] Herbert Eimert, "Einführung in die elektronische Musik", 1963,
LP, Wergo
[8] André Ruschkowski,: "Elektronische Klänge und
musikalische Entdeckungen", Verlag Philip Reclam jun, 1998
[9] Barry Truax, "Acoustic Communication", Ablex Publishing, 2001
[10] Barbara Koerppen , Neue Musik Zeitung (NMZ) 2002/06, 51. Jahrgang,
Seite 48
[11] Der Musikbrockhaus, Wiesbaden: Brockhaus, Mainz: Schott, 1982