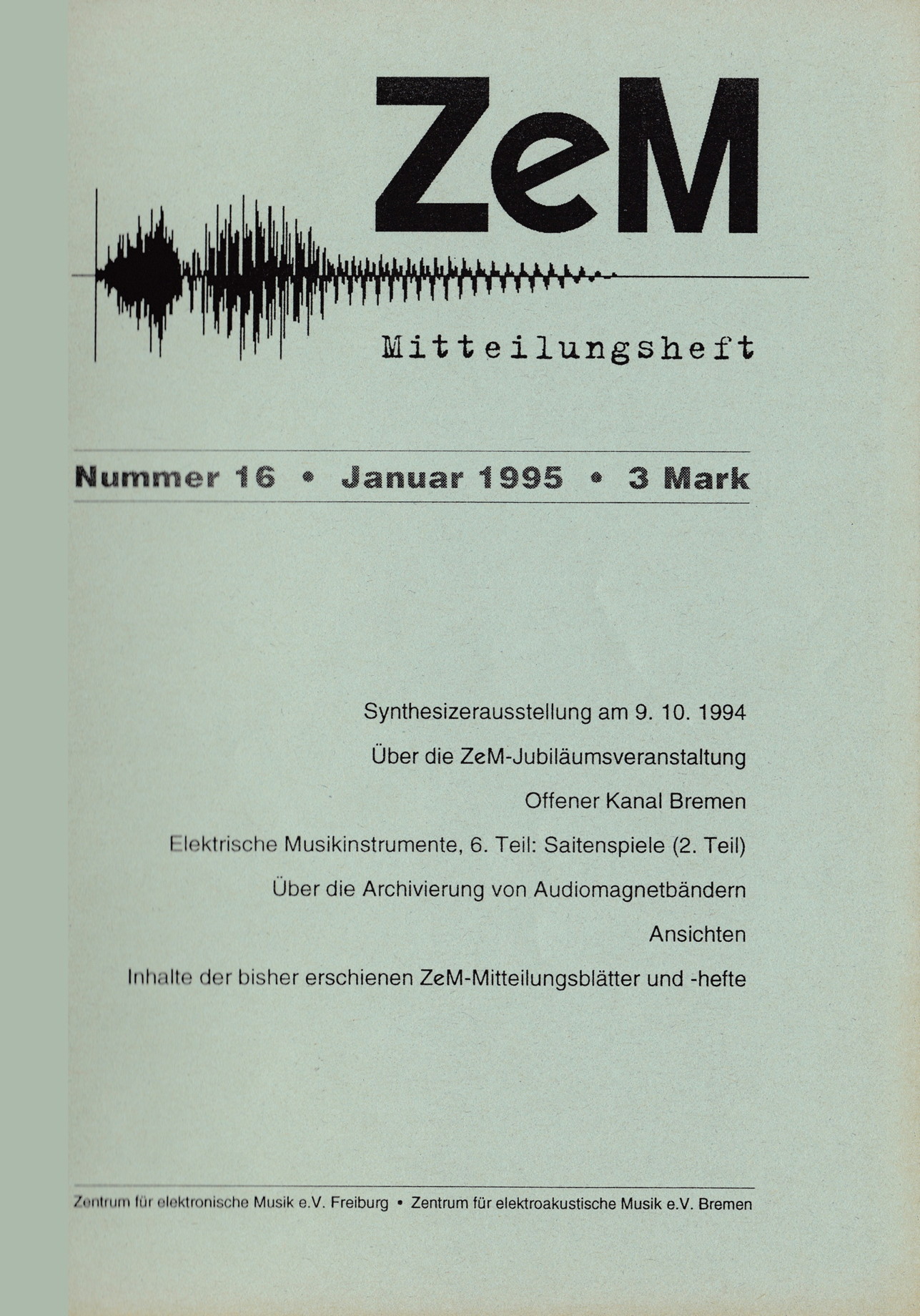 ZeM Mitteilungsheft Nr. 16 - Januar 1995
Redaktion: Joachim Stange-Elbe und Doris Elbe
Editorial
Nach fünf Jahren ZeM präsentiert sich das Mitteilungsheft in einem »neuen Gewand«. Layout und Typographie wurden von der neuen Redaktion grundlegend überarbeitet. Der Erscheinungsrhythmus - viermal pro Jahr - soll auch 1995 eingehalten werden. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn wir als Komponisten und Produzenten Elektronischer Musik unsere Gedanken in Worte zu fassen versuchen. Neben Erfahrungsaustausch, Veranstaltungsrückblick und Mitteilungen rein technischer Art, soll das Mitteilungsheft in erster Linie ein Forum für die geistigen Hintergründe der Elektronischen Musik an der Schwelle zum nächsten Jahrhundert sein.
Der Redaktion sind Artikel jederzeit herzlich willkommen: es genügt eine Diskette mit einem Text (bitte im ASCII-Format) oder eine Übermittlung via e-mail.
↑Aus gegebenem Anlaß möchte ZeM Bremen e.V. darauf hinweisen, daß Urteile und Meinungen, die von Mitgliedern von ZeM Freiburg e.V. in diesem Heft veröffentlicht werden, sich nicht unbedingt mit Urteilen und Meinungen von ZeM Bremen e.V. decken. Wir bitten die Personen und Institutionen, die sich hiervon in der letzten Zeit negativ betroffen fühlten, zur Kenntnis zu nehmen, daß verantwortlich für einen Artikel stets nur der/die Autor/in des Artikels ist und sonst niemand. Vor allem ZeM Bremen legt Wert auf die Tatsache, frei von Dogmen, Pauschalurteilen und Gruppenzwang zu sein. Uns geht es um Musik und um die Menschen, die sie hören. Nicht um irgendwelche Hahnenkämpfe zwischen den Institutionen. Erwin Koch-Raphael im Dezember 1994 (Schriftleiter von ZeM Bremen e.V)
↑Der letzte Tagesordnungspunkt dieser Wochenendveranstaltung zum fünfjährigen
ZeM-Jubiläum war die Synthesizer- bzw. Instrumenten-Ausstellung. Plötzlich
nahm die Teilnehmerzahl noch einmal zu, denn ca. 10 Techno-Jünger
- wie ich nach ihrer Kleidung und ihrem Interesse vermute - betraten den
Saal. Da Instrumente aus allen Epochen der modernen Elektronik (seit ca.
1960) vertreten waren, möchte ich nicht nur eine bloße Auflistung
der Geräte betreiben, sondern eine wertende, ungefähre Einordnung
in vier Epochen vornehmen (I - IV). Ich habe dabei um Trennung von Fakten
und meiner - vielleicht extremen - Privatmeinung (kursiv) versucht. Zum
Schluß und zum Jahreswechsel habe ich mir einige Gedanken über
die zukünftige Entwicklung der elektronischen Musikinstrumente gemacht
(V).
I. Am Anfang war ... das analoge Modularsystem (1950 ? - ca. 1985)Ausgestellt waren:
Modulsythesizer für den Audio-Bereich gab es schon 1950 bei den Universitäten und Radiosendern, nicht immer für musikalische Zwecke, sondern auch zur Meßtechnik. Der Benutzer konnte durch die freie Wahl der Anzahl und der Art der Moduln einen maßgeschneiderten Aufbau erstellen lassen. Die billiger werdende Transistor-Technik wirkte sich segensreich aus, indem die Geräte preiswerter, zuverlässiger und sogar transportabel wurden. Aber die Handhabung der Geräte war äußerst schwerfällig. Zu einer musikalischen Aufführung oder Aufzeichnung hätte man viele Hilfskräfte zum Einstellen der Regler benötigt. Entscheidend wichtig war daher die Idee der universellen Spannungssteuerung, die in den sechziger Jahren ausgeführt wurde. Sie eröffnete den Weg von vereinzelten Basteleien zur universalen Musikmaschine und ist der erste entscheidende Meilenstein in der Geschichte der elektronischen Musikinstrumente. Jedes Modul konnte dadurch mit allen anderen Informationen austauschen, indem einfach eine entsprechende Spannung mittels Kabel oder Kreuzschienenfeld die Ansteuerung übernahm. Die maximale Spannungsauslenkung war festgelegt (meist + - 10V) und im Idealfall war jeder Parameter (wie Frequenz, Amplitude etc.) spannungssteuerbar und das in - zumindest theoretisch - beliebig feiner Auflösung! Es gab prinzipiell keinen Unterschied zwischen Spannungen mit Audio-Frequenz (bis 20000 Hz) und Sub-Audio-Steuerspannungen (unter 20 Hz). Instrumente verschiedener Hersteller konnten einfach kombiniert werden und sich gegenseitig ergänzen. Ein gutes Modulsystem war nach außen immer offen, d.h. Mikrofone und Tonbandmaschinen etc. konnten problemlos mit einbezogen werden. Der Benutzer konnte durch Stecken von elektrischen Verbindungen direkt in die Synthese-Architektur eingreifen; prinzipiell waren alle Synthesearten realisierbar und durch die Spannungssteuerung automatisierbar. Hier eine kleine Auflistung der Freiheitsgrade, die z. B. das Soundlab-System der Fa. Dr. Böhm (1983) bot:
Das elektronische spezielle Know-How war anfangs nur in den USA vorhanden,
und durch diesen Vorsprung dominierten die Amerikaner klar bis in die achtziger
Jahre den Markt. Das erste kommerzielle spannungsgesteuerte Instrument
war das Moog Modular System, das bald viele Nachahmer fand. Ende der siebziger
Jahre gab es sogar ein Selbstbausystem der Zeitschrift Elektor (Elektor
Formant), denn die Preise für elektronische Komponenten waren mittlerweile
dermaßen gefallen, daß für die Kosten eines Modulsystemes
nur noch der mechanische Aufbau (Gehäuse) und die Arbeitskosten maßgebend
waren. Das System genügte durchaus professionellen Ansprüchen
und hatte Module, die man in vielen kommerziellen Instrumenten vergeblich
suchte:
Die Probleme der analogen Modulsysteme sollen nicht außer Acht gelassen werden, es gibt unter ihnen arge Rauscher und Brummer. Wer unbedingt mit festgelegten Frequenzen (Skalen) arbeiten will, kann durch Temperaturdrift und Offset zur Verzweiflung getrieben werden. Die Wartung der "Dinosaurier" kann einem Alpträume bereiten, denn sie enthalten extrem viele Einzelbauteile, so daß die Wahrscheinlichkeit eines Defektes in den nächsten Jahren gegen 1 tendiert. Durch den Fortschritt der Analogtechnik (z.B. integrierte, rauscharme, temperaturkompensierte Schaltungen) sind diese Probleme bei modernen Modulen heute überwunden. (Ein gutes Beispiel für die Verbesserungen ist das o. g. Soundlab-System von Dr. Böhm, das leider ein kommerzieller Flop war. Die Gründe dafür sind in II und III beschrieben.) Technisch war es voll auf der Höhe der Zeit, und z. B. viel flexibler als ein Moog oder Roland und diesen auch von der Audio-Qualität her weit überlegen. Es bleibt aber der Ärger mit der Reproduzierbarkeit. Einmal gefundene Einstellungen sind nicht einfach wiederauffindbar, schon gar nicht auf Knopfdruck. Hier heißt es neu stöpseln und schrauben. Eine Live-Aufführung von EM wird somit sehr aufwendig und risikobehaftet. Schließlich gibt es für die Analogtechnik unüberwindbare Grenzen. Beispiel:
Leider wurde bei jeder folgenden Generation von modularen Synthesizern die Vielseitigkeit wohl aus wirtschaftlichen Gründen mehr und mehr eingeschränkt. Und leider tendierten viele Anwender dazu, eine Standard-Verschaltung einzusetzen (VCO -> VCF -> VCA). Sie benutzten - weil sehr einfach zu durchschauen und anfangs spektakulär - nur das Tiefpassfilter zur Klangformung, bis hin zur festverdrahteten Synthese eines monophonen Minimoog, der nur noch Teilschaltungen mit dem Modularsystem gemein hatte. Das Roland System 100M bot hierfür z. B. ein eigenes, vorverdrahtetes Modul. So entstand eine Paradoxie: der "typische" Synthesizersound. Das sollte Folgen haben (siehe II). Auch ich habe mich von diesem "Einheits-Sound" täuschen lassen, und mein Selbstbau-Modulsystem nicht fertiggestellt. Ich bedauere dies heute sehr, denn das praktische Nichtvorhandensein von analogen Modulsystemen hinterläßt heute ein gehöriges Loch im Raum aller möglichen Klänge, das auch nicht mit dem Einsatz von noch so vielen Midi-Expandern zu stopfen ist. Erfolglos bleibt z. B. der Versuch mit einem modernen digitalen oder hybriden Gerät, ein weißes Rauschen durch einen Bandpaßfilter zu schicken, der wiederum in Frequenz und Resonanz von Sinus-Oszillatoren moduliert wird; erst langsam, dann immer schneller bis weit in den Audiobereich hinein und das ganze mit Hüllkurvensteuerung automatisiert! Habe ich jetzt das Interesse des Lesers geweckt und ist das Bankkonto
entsprechend gefüllt, so kommt die Bestellung eines maßgeschneiderten
Modularen Systems bei Donald Buchla (USA) oder EMS (England) in Betracht,
die auch heute noch Einzelexemplare bauen. Sonst bleibt heute nur der Selbstbau,
was auch viele Vorteile bei der Wartung des Instrumentes bietet. Zum Glück
werden die speziellen integrierten Schaltungen immer noch hergestellt.
II. Analoge, mehrstimmige (polyphone) Synthesizer mit festverdrahteter Klangerzeugung (1976 - 1983)
Die eigentliche Klangerzeugung blieb weiterhin streng analog. Allerdings waren die einzelnen Komponenten, wie Oszillator, Filter, Hüllkurvengenerator etc. bereits als Integrierte Schaltungen erhältlich. Es war sogar die komplette Klangerzeugung in ein einziges IC integrierbar. Man ging hierbei von populären Vorbildern der monophonen Zeit, wie z. B. dem Minimoog aus. Damit war die Verschaltung der einzelnen Elemente natürlich festgelegt, und konnte nicht mehr vom Benutzer frei gewählt werden (VCO -> VCF -> VCA). Zum Teil waren pro Stimme 2 oder sogar 3 Oszillatoren vorhanden, so daß additiv Obertöne nachbildbar waren, oder durch Synchronisation oder Modulation originelle Spektren erzeugt werden konnten, oder einfach reichhaltige Schwebungen entstanden. Der technische Fortschritt in der Konstruktion brachte einige Vorteile mit sich. EM wurde in der Erzeugung erschwinglicher und somit auch populärer. Die Abspeicherbarkeit von Soundeinstellungen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Mikroprozessorsteuerung machte selbst solche Features wie Autotune (Selbstabgleich des Systems) möglich. Die Betriebssicherheit und Temperaturstabilität konnte durch den Einsatz von integrierten Schaltungen extrem verbessert werden und die Mehrstimmigkeit wurde so erst bezahlbar. Die Industrie hatte richtig auf die Sorgen und Nöte der meisten Musiker reagiert, dem breiten Live-Einsatz von Synthesizer-Teppichen und Effekten in der Popmusik stand nun gar nichts mehr im Wege. Aber es gab, wie bei jedem technischen Fortschritt, auch Schattenseiten, besonders für die experimentelle Musik. Bis auf wenige Exoten war niemand mehr bereit, Modulare Systeme zu unterstützen; die "Dinosaurier" waren zum Aussterben verurteilt. Die Ausstattung der neuen Geräte mit Modulationshilfen (LFO, ADSR) war meist dürftig. Die Anzahl der möglichen Skalen betrug nun genau 1 und die festverdrahtete
Synthese erzeugte immer dieselben Filter-Wahs, die bald abgedroschen klangen.
Der Höhepunkt in der Entwicklung dieser Systeme war mit der Einführung
des Oberheim-Xpanders (1985) erreicht. Auch hier wurde an der festverdrahteten
Synthese festgehalten, nur die Mikroprozessorsteuerung wurde ausgefuchster
und übernahm nun die gesamte, sehr reichhaltige Klangmodulation (LFO,
ADSR, "Modulationsmatrix").
(Fortsetzung ... im nächsten Heft)
↑Bevor ich in den Keyboards einen Hinweis auf die 5-Jahres-Jubiläumsveranstaltung des ZeM Freiburg gelesen habe, hätte ich nicht vermutet, daß eine derartige Vereinigung überhaupt existiert. Um so mehr war ich interessiert, was mich erwarten wird und was für Menschen das sind, die sich für die Verbreitung und Weiterentwicklung der elektronischen Musik einsetzen. Das Szenario in der PH Freiburg wirkte wie aus dem Physikunterricht in der Schule. Im Vordergrund von einigen Geräten und einer "Versuchsanordnung", die sich beim näheren Hinsehen als ein modularer Synthesizer entpuppte, referierte Klaus Weinhold über Ziele und Ideen des ZeM, wie es 1989 durch die Initiative einer Handvoll interessierter Menschen zur Gründung des Vereins kam. Die Ziele des ZeM sind (neben der Verbreitung der elektronischen Musik) Innovation und die Loslösung von althergebrachten Vorgaben der klassischen wie auch der populären Musik. Wie ich am darauffolgenden Wochenende in der Emmendinger Steinhalle erleben konnte, bezog sich der Anspruch der Innovation nicht nur auf das Kreieren neuer, ungehörter Sounds, sondern auch auf verschiedene strukturelle Aspekte hinsichtlich der Kompositionen. So waren die Hauptelemente der vorgeführten Werke seltener die 12 Töne unserer gewohnten europäischen Skala, sondern, sofern es sich nicht um rein atonale Klangkollagen handelte, teilweise recht abstrakt wirkende Überlegungen, die zu überraschenden Ergebnissen führten. Joachim Stange-Elbe zum Beispiel hatte als Grundüberlegung die Abstände der einzelnen Planeten zueinander analog in Form von Dynamikverhältnissen, Klangfarben- und Rhythmenveränderungen in eine Komposition übertragen. Walter Birg hingegen berechnete, basierend auf der irrationalen Konstanten e, eine neue Skala, in der sich seine Komposition dann bewegte. In beiden Fällen ging es mir allerdings so, daß ich die jeweiligen Vorüberlegungen ungleich interessanter fand als die Klangvorführungen, die darauf folgten. Das rührt daher, daß die Musik als sinnliches Ereignis, der Spaß an den Sounds, in beiden Stücken (ebenso in einem von Gerda Schneider) für mich zu kurz kam. Es wirkte wie ein Kunstwerk, das zuvor erst einmal erklärt werden muß, da es andernfalls eine wesentlich geringere Aussagekraft haben würde. Anders ging es mir bei den Stücken von Perper Weyren-Meler und Franz Martin Löhle, speziell bei denen, die auf dem Microwave realisiert wurden. Sie wirkten, nicht zuletzt auch durch die druckvollen Sounds des Microwave, direkter auf den "Bauchbereich" und vermochten bei mir spontane Assoziationen wie bildlich-plastische Vorstellungen der Sequenzen und Sounds hervorrufen. Auch die Kompositionen von Klaus Weinhold haben mir durchweg recht gut gefallen, obwohl die Klänge, die er live aus seinem K2000 holte, ziemlich "böse" klangen. Die vom Tonband vorgespielten Stücke klangen durch die verwendeten Sounds und die größtenteils selbst erstellten Samples interessant und ungewohnt. Bis darauf, daß Klaus Weinhold von manchen Stücken mehrere Versionen vorspielte, die sich nicht besonders stark voneinander unterschieden, wurden die Kompositionen auch nach mehreren Minuten nicht langweilig. Das traf besonders auf eine Reihe bekannter klassischer Werke zu, die er mit Hilfe des Samplers neu instrumentiert hatte (sehr originell fand ich die "Vogelstimmen-Sinfonie"). Alles in allem haben die beiden ZeM-Wochenenden meinen Horizont doch erheblich erweitern können, indem ich erfahren habe, wie viele Herangehensweisen es bei der Komposition elektronischer Musik gibt. Interessant fand ich auch, daß die einzelnen ZeM-Mitglieder alle ihren ganz persönlichen Stil verfolgen, wodurch ein so relativ umfassender Eindruck von der Variabilität der elektronischen Musik erst möglich war.
↑Liebe ZeM-Mitglieder!Die Sendung "Homerecording" wird bis Anfang 1995 von Michael Rippel mit einem etwas anderen musikalischen Schwerpunkt weitergeführt. Der Sendetermin ist weiterhin der letzte Dienstag im Monat. Ich selbst plane eine weitere Staffel im Jahr 1995 und möchte Euch alle wieder dazu auffordern, mir Material zuzuschicken. Aus technischen und organisatorischen Gründen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr gleich mehrere (3 - 6) Beiträge auf einer einzigen Cassette unterbringen könntet. Die vielen Einzelcassetten machen mir langsam echte Lagerprobleme. Wer seine alten Bänder zurückmöchte, der sollte mit mir Kontakt aufnehmen. Ich beginne im Dezember 1994 mit der Produktion der Staffel, also schickt mir bitte Eure Beiträge bis zum 1. Dezember 1994 zu. Ich bin sehr gespannt, wie sich Eure einzelnen Stile weiterentwickelt (oder zurückentwickelt?) haben und freue mich auf die Cassetten. Bitte wieder ohne Dolby, aber gerne mit Dbx und High-Speed oder als DAT. Also, laßt Eure Plastikschachteln fröhlich piepsen oder unheilschwanger vor sich hin wabern. Auch bei der neuen Staffel gilt: Alles erlaubt ! Bis bald
PS. Bitte signalisiert mir, ob Ihr einverstanden seid, auf einer Adressenliste zu landen, die an alle aktiven Teilnehmer verteilt wird. So könnt Ihr untereinander Kontakt aufnehmen.
↑
Dr. Joachim Stange-ElbeElektronische Musikinstrumente.Ein historischer Rückblick mit zeitgenössischen Dokumenten.6.Teil: Saitenspiele (Fortsetzung und Schluß).Das HellertionAls letzter Vertreter und zum Abschluß unseres historischen Rückblicks der ersten elektrischen Klangerzeuger muß das Hellertion Erwähnung finden, nicht nur weil es dem Trautonium eng verwandt ist, sondern auch als einziges der damaligen Instrumente mehrstimmig spielbar war. Die beiden Erfinder waren der Musiker Bruno Helberger und der Physiker Dr. Peter Lertes, der lange Zeit Vorsitzender eines Zusammenschlusses technisch interessierter Radiofreunde war, aus der sich der Südwestdeutsche Rundfunkdienst, Frankfurt bildete. Sie entwickelten ihr Instrument in den Jahren 1928 - 1930 mit Unterstützung der Schneider-Opel A.G. Frankfurt-West und benannten es nach den Initialen ihrer Namen. Die Grundidee, ein mehrstimmig spielbares Instrument zu konstruieren, ließ sie die Art der Klangerzeugung von Magers "Kaleidosphon" und die Spielweise von Trautweins "Trautonium" verbinden: "Helberger, der Musiker und Erfinder, hatte an Lertes, den Konstrukteur, die Forderung gestellt, eine Apparatur zu schaffen, bei der Tonhöhe und Lautstärke jedes einzelnen Tones durch nur einen Finger geändert werden können, so daß es prinzipiell möglich sein muß, eine zehnstimmige Apparatur zu bauen, die mit allen zehn Fingern gespielt wird. Da jeder Finger zwei verschiedene Funktionen ausführen muß, konnte nur die Einordnung der beiden Funktionen in zwei verschiedene Richtungen in Frage kommen. Man entschied sich, durch eine Bewegung des Fingers in horizontaler Richtung die Tonhöhe und durch eine solche in vertikaler Richtung die Lautstärke zu ändern. Das Spielmanual für einen Ton besteht aus einer Widerstandsschine, auf der man mit dem Finger entlanggleitet, um die Tonhöhe zu bestimmen, während sich aus dem Druck, den der Finger in senkrechter Richtung ausübt, die Lautstärke ergibt. Dieser Widerstand, an dem auf sehr einfache Weise Tonhöhe und Lautstärke abgegriffen werden, ist der wesentliche Bestandteil des Hellertions" (Ohne nähere Verfasserangabe (mit Schw. gezeichnet), Das Hellertion, ein neues elektrisches Musikinstrument in: FUNK-Bastler, 1931, Heft 27, S. 425.). Diese Spieleinrichtung, von den beiden Konstrukteuren als "Bandmanual" bezeichnet, gab Anlaß zu patentrechtlichen Auseinandersetzungen mit Trautwein. Dieser hatte sich seine Erfindung des "Saitenspieles", zum großen ärger von Oskar Sala, nicht präzise genug schützen lassen. Zur Tonhöhenorientierung war das Bandmanual des Hellertions mit einem schwarz-weißen Papierstreifen unterlegt; im Gegensatz zum Trautonium, war es beim Hellertion allerdings möglich, durch übereinanderlagerung der einzelnen Manuale mehrstimmig zu spielen, jeder einzelne Ton konnte getrennt in der Lautstärke und Schwebung beeinflußt werden. Im Jahre 1933 veröffentlichte auch Peter Lertes seine "Elektrische Musik"; er verfolgte damit jedoch eine andere Absicht als Trautwein: Lertes kam es auf "eine gemeinverständliche Darstellung ihrer Grundlagen, des heutigen Standes der Technik und ihrer Zukunftsmöglichkeiten" an. Er legte großen Wert auf die Darstellung physikalischer und elektrotechnischer Zusammenhänge und die Historie der bisher entstandenen Klangerzeuger, wobei er sich ganz besonders auf die in- und ausländischen Patentschriften stützte. Auch über die klangliche Eigenschaft des Hellertions erfährt man in Lertes' Buch Näheres: "Die Klangfarbe des Instrumentes wird einerseits durch Zu- und Abschalten von Sieb- und Sperrketten, und neuerdings auch durch Formantkreise, wie sie insbesondere bei dem^Ê Trautonium Verwendung finden, und andererseits durch die Dynamik des Spiels geändert^Ê . Die Einstellung der einzelnen Instrumentalstimmen auf die verschiedenen Klangfarben erfolgt durch Druckknöpfe, die ... vor dem vorderen Manual erkenntlich sind. Dabei besteht natürlich auch die Möglichkeit, die einzelnen Stimmen auf voneinander verschiedene Klangfarben einzustellen ... Sehr wesentlich ist jedoch die Klangfarbenänderung durch die Dynamik des Spiels, ein ... Beweis dafür, daß mit dem Spielmanual.. die Möglichkeit geboten ist, den elektrischen Tonansatz und damit die Einschwingvorgänge weitgehendst zu beeinflussen" (Peter Lertes, Elektrische Musik, S. 177f.). Eine nähere Charakterisierung der verschiedenen Klangeigenschaften unternimmt Lertes nicht, er erwähnt nur beiläufig die Möglichkeit, durch unharmonisch mehrstimmiges Spiel "Geräusche naturgetreu nachzuahmen oder neue Geräuscheffekte zu erzielen" (Ebenda, S. 178.), wodurch eine Verwendung des Hellertions zur Begleitung oder Untermalung von Filmen sich sehr gut eignen würde. über eine Verwendung in eigens dafür geschriebenen Kompositionen ist nichts bekannt, und den Zweiten Weltkrieg hat keine Konstruktion überdauert. Bei allen bisher vorgestellten Konstrukteuren wurde ersichtlich, daß sie die Schaffung einer neuen Klangwelt anstrebten und nicht die traditionellen Instrumente nachzuahmen trachteten. Die Durchsetzung dieser neuen Klangmöglichkeiten war jedoch sehr schwierig, da es an geeigneten Kompositionen für diese Instrumente fehlte. Die meisten Erbauer und Spieler wichen daher in die Bereiche der illustrativen Filmmusik und der Hörspielgestaltung aus, bei der sie ihre neuen Instrumente in freier Form klanglich und musikalisch erproben konnten. Wurden die elektrischen Instrumente dennoch von einigen Komponisten mit Werken bedacht, so ging ihr Einsatz über ein bislang schon gekanntes konventionelles Maß nicht hinaus. Die neuen Instrumente wurden wie die alten behandelt, von neuen kreativen Ansätzen war wenig zu spüren. So huldigen auch die Trautonium-Konzerte von Hindemith und Genzmer diesen Prinzipien. Einzig die scheinbar "formlose" Film- und Hörspielbegleitmusik bot hier reichere Entfaltungsmöglichkeiten, die Oskar Sala auch heute noch mit seinem Mixturtrautonium ausnutzt. Durch diese Gegebenheiten blieben die elektrischen Instrumente weitgehend dem Medium treu, dem sie technisch und künstlerisch entsprangen. Eingebunden in eine Musik, die für die Medien Film und Hörfunk gedacht und geschrieben ist, konnte sich die elektrische Musik in "ihrem Bereich" voll entfalten. In der traditionellen Musik haben sich diese Klangerzeuger auf dem Konzertpodium nicht durchsetzen können. (Hiermit ist die Serie "Elektrische Musikinstrumente. Ein historischer Rückblick mit zeitgenössischen Dokumenten" beendet. Für ein Feedback, weitere Informationen und Materialien steht der Autor gerne zur Verfügung. Er ist erreichbar unter der e-mail joachim at stange-elbe punkt de
1. Teil: Die Prophezeiung eines
"Technikers" - ZeM
Nr. 4 (I/1991)
↑Die Archivierung von Audio-Magnetbändern ruft nach einigen Jahren unter Umständen ganz spezifische Probleme hervor, deren Lösung nicht einfach ist. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Lagerung und die Raumbedingungen selbst. Nach einem tropisch feuchten Sommer mit monatelangen Hochtemperaturabschnitten sowie Windstille und damit gefährlich erhöhter Luftfeuchtigkeit wird das Abspielen vieler Magnettonträger eine Katastrophe, die für die meisten der betroffenen Bänder bei unsachgemäßer Behandlung das Aus bedeutet. Beim Abspielversuch bilden sich dicke Schmierstellen an Tonköpfen und Bandführungen, die auch bei Maschinen mit kräftigen Wickelmotoren nach kurzer Zeit zum Bandstillstand führen, der Abspielversuch wird von diesen Schmierstellen, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen, durch deren Bremswirkung vereitelt. Erfahrungswerte zeigen sogar einen zunächst widersprüchlichen Zusammenhang, nämlich, je kräftiger die Zugkräfte der Wickelmotoren, umso stärker wird das Magnetband an die Bandführungsteile gepreßt und umso eher kommt es durch Abrieb zum Stillstand. Nicht alle Bänder sind davon betroffen. Bei BASF z. B. gibt es nach Jahren nur einen tolerierbaren Bandabrieb. Andere Bandsorten - wie auch Revox 631 - verhalten sich regelrecht bösartig. Sehr oft gereicht das Beharren der Hersteller auf "alten" Rezepturen für die Zusammensetzung von Magnetbändern hier zum Vorteil. Grund für starke Schmierstellen ist die teilweise Auflösung der Leimschicht, die die Magnetschicht mit dem Träger verbinden soll. Der Aufgabenbereich für beide ist kompliziert, es wirken Magnetpartikel, Bindemittel, Gleitmittel, Fungizide, Zusätze zur Sicherung der Leitfähigkeit, Stabilisatoren usw. zusammen. Manche Hersteller verwendeten zeitweise einen Kleber, der sich im Laufe der Zeit chemisch verändert. Alte Bandchargen sind vom Verfall weit weniger betroffen als Material besonders um und nach 1980. "Im Magnetband wird ein vernetzter Polyester-Polyurethan-Binder benutzt. Ein Polyester ist eine Kette von Ester-Verbindungen. Ester bildet sich aus chemischen Reaktionen zwischen Säuren und Alkoholen. Eine solche Reaktion setzt als Nebenprodukt Wasser frei ... Glücklicherweise ist Hydrolyse reversibel und tritt nicht notwendigerweise bei angemessenen Lagerbedingungen auf." (zitiert nach einem Brief von F. Engel / BASF an den Verfasser, aus: Walter E. Davies, Preserving Magnetic Tapes, Broadcast Engineering, October 1987).(1) Besonders wichtig erscheint zunächst, daß der Vorgang der Wasserbildung - die Hydrolyse - reversibel ist, was besagt, daß sich diese auftretende Feuchtigkeit zurückbilden kann. Darauf hinzuarbeiten ist oberste Notwendigkeit, wenn der Zustand akut geworden ist, die Tonkopfverschmutzung und die Abriebe an bandführenden Teilen abnorm zunehmen. Die Lagerbedingungen:1. Band auf dem rechten Wickelteller belassen ("tail out" lagern), um Vorechos zu vermeiden. Haben sich Vorechos bereits massiv eingeschlichen, muß ein sogenannter "Echo Razor"(2) eingesetzt werden. Der aber kann nur funktionieren, wenn das zu behandelnde Band an der Oberfläche intakt ist. 2. Das Band mindestens im Jahr einmal umspulen, damit angesammelte Feuchtigkeit und Alkoholanteile entweichen können, sowie der Kopiereffekt durch mechanische Belastung unterbrochen wird. 3. Die Raumtemperatur sollte 23 Grad Celsius niemals überschreiten, da der Kopiereffekt ab da mit zunehmender Raumtemperatur ansteigt. Ideal wären konstant 2O Grad Celsius. Aber: Die idealen Lagerbedingungen werden oft nicht einmal in Rundfunkanstalten eingehalten. 4. 50% Luftfeuchtigkeit gelten für die Bandlagerung als ordentlicher Wert, besser bleibt man darunter (Klimaanlage!, in seltenen Glücksfällen genügt ein geeigneter Keller). Zur Diskussion stellen möchte ich noch die Lagerung in einem Kühlschrank mit sehr geringer Kühlleistung, wobei in diese Überlegung einbezogen werden muß, daß das Aggregat in gekapseltem Zustand keine Induktionsströme oder elektrische Felder abgeben soll. Ist die Kühltemperatur zu niedrig, z. B. 5 Grad Celsius, kristallisiert das Gleitmittel und tritt als weißliche Schicht aus. Dadurch entstehen Kopfzusetzer und plattenförmige Abriebe an Bandführungsteilen. Es ist allemal eine gründliche Überlegung wert, ob von diesen Prozessen des Zerfalls nicht jegliche Magnetschicht, die mit Hilfe eines "Klebers" der oben beschriebenen Sorte auf einen Träger montiert wurde, betroffen ist. "Disketten, DAT-Bänder, S-VHS-Bänder haben jeweils verschiedene Rezepturen, in denen sich natürlich immer wieder gleiche oder ähnliche Komponenten wiederfinden." (Friedrich Engel, BASF, Fax an den Verf. vom 7. 10. 1994) Dann sind nämlich auch digitale Systeme gefährdet, bis hin zur simplen Diskette, wobei diese noch am wenigsten Schaden nehmen dürfte, da ja hier keine Schichten dicht aufeinander gewickelt sind. Die Diskette ist aber ebenso einer unmittelbaren mechanischen Belastung seitens des Abtastvorgangs ausgesetzt, nicht hingegen die Festplatte. Auch der Lesekopf einer Floppy kann zuschmieren. Den Absonderungen an der Oberfläche der Magnetschicht - wenigstens der Hydrolyse - versuchen die Hersteller beizukommen (so Engel / BASF), können sich jedoch nur auf die Wahrscheinlichkeit von Tests verlassen. Praxiserfahrungen wird die Zukunft bringen. Der Kopiereffekt ist bei dicht übereinander gewickelten Magnettonträgern eine generell entstehende Störung der Aufzeichnung. Seine Größe hängt ab von der Dicke des Bandes, besonders des Trägermaterials, der Beschaffenheit der Rückseite und der Frequenz, sowie der Amplitude der Aufzeichnung. Bis zu einem gewissen Grad ist folglich die Kopierdämpfung von der Konstruktion, dem Aufbau des Bandes abhängig, auch natürlich von der aufgezeichneten Wellenlänge.(3) Der Kopiereffekt scheint sich bei gewickelten Tonträgern generell nicht in vernachlässigbaren Dimensionen zu bewegen. Liest man beispielsweise die Betriebsanleitung zum ADAT-Digital-Recorder, so steht im Kapitel 9.3 "Cassettenpflege", daß diese im Jahr einmal vollständig umzuspulen sei, "So vermeiden Sie Vorecho-Effekte ...". Übersprechen zwischen den Schichten vollzieht sich demnach auch bei Digitalbändern. Die Frage ist, inwieweit es wirksam werden kann. Oder man hat bei Alesis-ADAT diesen Passus unreflektiert aus der Anleitung für eine Analog-Mehrspur-Maschine übernommen, denn technisch gesehen schreibt eine DAT-Maschine die Digitalwerte natürlich in digitaler Form auf, und diese besteht in positiver und negativer Sättigung des Aufzeichnungsbandes. Entscheidend aber sind die unvergleichlich kürzeren Wellenlängen, die mit dem Audiobereich auch ganz entfernt überhaupt nichts zu tun haben können, also ist hier ein potentieller Sicherheitsfaktor gegen Übersprechen bei allen digitalen Aufzeichnungsformen von Audiosignalen vorhanden, denn ein durch Übersprechen kopiertes Signal kann niemals die Amplitude bzw. den Sättigungswert eines direkt aufgeschriebenen Digitalsignals erreichen. Durch die mechanischen Unsicherheitsfaktoren der Bandoberfläche ist also - die Langzeitstabilität betreffend - offenbar von der digitalen Aufzeichnung ebensowenig absolute Beständigkeit zu erwarten, wie von der analogen. Und bedenkt man, daß - wie noch zu zeigen ist - ein Spulenband eher in einen lauffähigen Zustand zu bringen ist, als eine Cassette, weil unmittelbar am Band manipuliert werden kann, dann bleibt nur die Diskussion um "digital" oder "analog" als Entscheidungskriterium für die Aufzeichnungsmethode und, was die Tonqualität betrifft, darf man die Überlegungen der Herren Neve, Schiefele, van den Hul, Klimo und vielen, vielen anderen, die vehement mit tragfähigen Argumenten das analoge Klangbild verteidigen, nicht ausgrenzen! Für die Massenproduktion reicht noch allemal die 16-bit-Technologie. Was nun aber, wenn das Dilemma eingetreten ist, wenn die Bänder hochwertige Aufnahmen nicht mehr hergeben wollen. Meine Erfahrung nach diesem Sommer hat gezeigt, daß dem Abrieb, sowohl dem braunen (Magnetschicht), wie dem weißen (Leimschicht), die oft genug nicht zwangsläufig zusammen auftreten, schon beizukommen ist. Da der meiste Abrieb sich an starren Bauteilen , z. B. dem rechten Umlenkteil einer Revox-Maschine sammelt, kann man diese gegen eine bewegliche, kugelgelagerte Rolle austauschen. (Kostenpunkt im Selbstservice etwa 3O,- DM, zugehörige Beilagscheiben gleich mitbestellen). Machtlos ist man dagegen, wenn die Antriebswelle sehr stark aufgerauht ist (Revox machte das gewisse Zeit. Das war wohl des Guten zuviel, um eine einwandfreie Traktion des Bandes zu sichern), dann wird die Magnetschicht regelrecht beackert, zerrieben, und geht unweigerlich ab. Aufgerüttelt durch mehrfache Meldungen und konkrete Hilferufe aus dem Freundeskreis, habe ich meine eigenen Bänder inspiziert und das Phänomen eben an einem Revox 631 entdeckt. Da dieses Band dem Geruch nach von Scotch stammen könnte (das Revox 641 ist identisch mit dem Ampex 457, so die Auskunft von Tonstudiobedarf Bluthard, Stuttgart)(4), lassen sich berechtigte Schlüsse auf die Zustände bei einigen Professional-Bändern ziehen. Beim Umspulen habe ich alle meine Bänder durch ein neutrales, trockenes Tempo-Taschentuch laufen lassen, das ich zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand hielt, um den Druck auf das Band regeln zu können. Davon ist mehr zu halten als von einem mit Vlies (Viledon DT 1452 weiß, zitiert nach BASF)(2) überzogenen Löschkopf, da die Abriebe auf der Vorder- und Rückseite des Bandes gleichermaßen auftreten können. Besonders rückseitenmattierte Bänder machen Schwierigkeiten. Das Tuch kann rasch gegen ein sauberes gewechselt werden, obwohl der Reinigungsvorgang so wenig wie möglich unterbrochen werden sollte, da der angesammelte Klebstoff bei einem Bandstop am Band festhält und man dann zusehen muß, wie er von dort wieder wegzubekommen ist. (Hilfreich ist dabei die Kunststoffnagelfeile "Niegelob / Solingen" mit einem löffelförmigen Ende). Erfolge kann es bei sehr stark schmutzenden Bändern, die ansonsten unbrauchbar wären, geben, wenn man diese mehrfach unter Umgehung der Bandführungsteile - nur direkt von Wickel zu Wickel - mit größter Vorsicht umspult, dabei mit Tempotuch reinigt und nach einer Pause von mehreren Tagen das Band über Bandführungen normal, "tail out" aufwickelt. Bei der überwiegenden Zahl der Bänder stellte ich fest, daß der Abrieb an den Bandkanten am stärksten war, in der Bandmitte sich oft gar keiner fand. Daraus läßt sich folgern, daß der Abrieb wesentlich durch die von außen ans Band gelangende Luftfeuchtigkeit verursacht wird. Die externen Einflußfaktoren spielen eine wichtige Rolle. Zu hinterfragen ist auch, ob es Sinn macht, ein Magnetband in der immer mitgegebenen Kunststoffhülle aufzubewahren, weil das Band möglicherweise am eigenen Hydrolysevorgang zugrunde geht und diese Verpackung gegen tropische Langzeit-Lagerbedingungen machtlos ist, eher wäre der Einsatz hygroskopischen Materials zu überlegen. Den Reinigungsvorgang kann man durchaus zeitlich etwas vorziehen. Die Überspielung der Bänder verlege man am besten in einen sehr trockenen Wintermonat. Die freigesetzte Feuchtigkeit hat bis dahin Zeit, sich zurückzuziehen (einen beheizten Raum vorausgesetzt). Die Restmenge wird schließlich während des Umspulens abgegeben. Stellt sich heraus, daß der Abrieb durch das Tempotaschentuch erheblich reduziert werden kann, soll schließlich der ganz normale Abspielvorgang dafür sorgen, daß die Bandwickel so glatt wie möglich ausfallen. Beim schnellen Umspulen entstehen sogenannte überschießende Wickelteile, wobei sich einzelne Lagen aus dem Wickel herausheben. Vor allem, wenn die Achsen der Wickelteller und der Dreizack nicht geometrisch gerade sind. Für kurzzeitige Lagerung kann das bleiben. über längere Zeit so belassen, neigt das Band zu Verformungen an den Bandkanten, die schließlich beim Abspielen für Unregelmäßigkeiten sorgen, die hörbar sein können. Die Feuchtigkeit kann man radikaler durch Aufheizen in einem Ofen, auch Mikrowelle, loswerden. Der Vorgang ist jedoch meiner Meinung nach dermaßen riskant, daß ich unbedingt die Lektüre der unten angegeben BASF-Schrift empfehle, da ich die Haftung für mißratene Versuche gewiß nicht übernehmen werde. Literatur und Quellen: (1) Walter E. Davies, Preserving Magnetic Tape, in: Broadcast Engineering, October 1987 (2) Nachbehandlung von Audio-Archivbändern, V/MT, A. Vögeding, 11. 04. 1994, BASF PROFESSIONAL AUDIO VIDEO (3) Johannes Webers, Tonstudiotechnik - Schallaufnahme und - Wiedergabe bei Rundfunk, Fernsehen, Film und Schallplatte, Franzis / München, 1968, hier: Zustand des Tonträgers nach der Aufzeichnung, S. 287 ff. (4) Tonstudiobedarf Heinz Bluthard, 70173 Stuttgart 1, Neue Brücke 6, Tel 07 11 / 29 76 90, Fax 07 11 / 2 26 83 07
↑
Wir Elektroniker, ich als Musiker, die zumindest den Versuch machen,
Elektronische Musik zu produzieren, suchen nicht nur in uns nach Rechtfertigungen
für unser Tun, wir suchen in außer uns liegenden, vielleicht
geschichtlichen Autoritäten, in der theoretischen Literatur etwas
zu unserer Unterstützung und Legitimierung zu finden.
Im neuen Keyboardheft (Februar 95) schreibt einer der Redakteure einen hinweisenden Bericht über einen neuen Sampler: "Sampler gehören zu den kreativsten Werkzeugen, die die Musikinstrumentenindustrie derzeit zu bieten hat. Dieses Genre stellt nämlich nicht nur dem gelernten Musiker und Produzenten ein vorzügliches Arbeitsmittel zu Verfügung. Vielmehr bietet der Sampler wie kaum ein anderes Instrument denjenigen, die nicht in den Genuß einer musikalischen Grundausbildung gekommen sind bzw. die Chance hatten, ein Instrument von der Pike auf zu erlernen, die Möglichkeit, einen Weg zur selbstgemachten Musik zu finden." Dies ein ganz neues Zitat zur Elektronischen Musik, besser wohl zur Computermusik, denn der Untertitel der Zeitschrift beruft sich auf den Computer. Von Musik ist hier die Rede, die Definitionen über das, was Musik ist oder zu sein hat, sind in der Literatur Legion. Greifen wir zwei willkürlich heraus: In MGG findet sich erstens folgender Abschnitt: "Die Musik ist eine Kunst-Disziplin, deren Material aus Tönen besteht. Von dem in der Natur vorkommenden Tonmaterial gelangt in der Musik nur ein verhältnismäßig geringer Teil zu Verwendung. Die aus der unendlichen Zahl von Naturtönen ausgewählte, endliche Zahl von musikalischen Tönen wird durch bestimmte Rationalisierungsprozesse zu bestimmten Tonsystemen zusammengeschlossen. Jedoch erschöpft sich das Wesen der Musik keineswegs allein in den Tönen. Sie ist vielmehr im Grunde und Kern ihres Wesens ein geistiges Prinzip, eine Idee, die in Tönen Gestalt gewinnt. Insofern aber die Musik ihre tiefste und letzte Verankerung im Bereich des Geistigen hat, ist ihre Geschichte Geistesgeschichte." Für die Musik des 20. Jahrhunderts findet sich zweitens in dem neuen Katalog der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft eine interessante Definition für das, was man im weitesten Sinn als Elektronische Musik bezeichnen kann. Es ist dort von einem Entwicklungsstrang die Rede, der mit einem Bruch der historischen Entwicklungslinien um 1950 einhergeht und zu einer völligen Loslösung von allen bisher als verbindlich anerkannten Parametern der Form und des Inhalts führt. Ein weiteres hiermit in Zusammenhang stehendes Statement äußert der ehemalige Freiburger Komponist F. Zipp in einem Buch über das Wesen der Musik: "Es steht jedoch fest, daß sich in der Elektronik mit dem Antrieb zur Expansion in Neuland ein ebenso starker Antrieb zum Ausschließen des bisherigen musikalischen Reichtums und zur Reduktion auf Stege und Stelzen einer artifiziellen Sonderkunst verbindet. über die Konsequenzen eines solchen Weges sollte sich niemand Illusionen machen, denn am Ende steht nichts Geringeres als die radikale und vollständige Zurücknahme der bisherigen abendländischen Musik. Einen vergleichbaren Vorgang hat es in der abendländischen Geschichte noch nie gegeben. Gerade dies aber kennzeichnet den elektronischen Typus am besten: Er nimmt einen Standpunkt abseits geschichtlichen Fühlens, Denkens und Sichverantwortens ein." Überall, auch im eingangs zitierten "Keyboard" ist von Musik die Rede. Alle europäischen Sprachen bilden dieses Wort in ihre Lautgestalt um. Es scheint im europäischen Raum nur ein anderes Wort für Musik zu geben, das gälische, es heißt ceol und bedeutet: ein Ton, wie ihn die Vögel von sich geben. Die gälische "Musik", also deren ceol, befand sich nördlich des sogenannten Hadrianwalles, eines Schutzwalles gegen die Kulturlosigkeit und damit auch gegen den Gesang der Vögel, den aber der bedeutende französische Komponist Olivier Messiaen in die traditionelle Musikkomposition eingeführt hat. Von ceol zum Sampler. Messiaen hatte große Mühe, die Vogelgesänge auf klassischen Instrumenten darzustellen, es ist viel guter Wille erforderlich, um die Vogelklänge etwa auf einer Orgel wiederzuerkennen. Mit dem Sampler hingegen - kein Problem. Die ersten Versuche, etwas zu samplen, gehen gerne in Richtung von Aufnehmen von Vogelgesängen und deren Verwandlung in alle möglichen anderen Klangereignisse. Damit kommt man zu einer "selbstgemachten" Musik, die keine musikalische Grundausbildung erfordert, sondern nur auf einer, hoffentlich vorhandenen, musikalischen Vorstellungskraft beruht. Die Musikdefinition von MGG wird sich dann allerdings verändern, vielleicht in ihre Inversion verwandeln, und so sei der Versuch gemacht, die MGG-Definition ein wenig zu verändern: "Die Elektronische Musik ist keine klassische Kunstdisziplin, deren Material nur aus Tönen besteht. Von dem in der Natur vorkommenden Klangmaterial gelangt in der Elektronischen Musik ein sehr großer Teil zur Verwendung. Die aus der unendlichen Zahl von Naturtönen ausgewählte endliche Zahl von musikalischen Tönen in der klassischen traditionellen Musik wird durch bestimmte technische Mutationsprozesse zu unbestimmten Klangsystemen auseinandergelegt. Jedoch erschöpft sich das Wesen der Elektronischen Musik keineswegs allein in den Klängen. Sie ist vielmehr im Grund und Kern ihres Wesens ein materielles Prinzip, ein energetischer Prozeß, der in Soundprozeduren sich installiert. Insofern aber die Elektronische Musik ihre tiefste und letzte Verankerung im Bereich des Materiellen hat, ist ihre geschichtslose Betrachtung Naturerkenntnis." Obwohl Autoren wie der oben genannte F. Zipp und die oben angeführte Katalogäußerung sicherlich noch nicht die aktuelle Elektronische Musik neuer Geräte kannten, wurde doch hier deutlich die Veränderung, Loslösung und Metamorphose des traditionellen Musiksystems erkannt. Der Autor Zipp zieht im weiteren Verlauf seiner Ausführungen die Konsequenz, daß elektronische Musik aufgrund ihrer "Unmenschlichkeit" abzulehnen sei und der Katalog "Musicus" der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft läßt diese neue Musik im Angebot nicht vertreten sein. Wir wissen also Bescheid. Es stellt sich die Frage, wo denn nun heute die hier angesprochene Elektronische Musik zu finden und zu realisieren sei. In GM, im PC, in der VL-Synthese, in neuen Digitalpianos oder in neuen Samplern? Wir haben versucht, im letzten Jahr eine konkrete Antwort zu geben, indem wir Instrumente der ersten Stunde und deren Hersteller nach Freiburg holten: Herrn Rehberg mit seinen EMS-Geräten. Sicher spielen hier persönliche Vorlieben eine Rolle, aber wer auf diese neue Elektronische Musik hingewiesen werden soll, wie sie in den obigen Zitaten quasi als Menetekel an die Wand gemalt wird, sollte zu diesen Geräten, zu denen auch das berühmte Roland 100M-System gehört, zurückkehren. Statt Auswahl, statt Zubereitung, statt geistigem Prinzip wird hier eine materiale Potentialität von unendlicher Fülle geboten, deren Eckpunkte die Sinusschwingung und auf der anderen Seite das Rauschen sind. Die Sinusschwingung, völlig bedeutungslos, keine Information übertragend, und das Rauschen, in dem alles vorhanden ist, aber nichtssagend und damit bar jeden geistigen Prinzips. Wir versuchten, Rechtfertigungsgründe für die Elektronische Musik zu finden. Ein bedenkenswerter findet sich in Thomas Manns Roman Doktor Faustus, in dem die musikalischen Gedanken des Helden Adrian Leverkühn geschildert werden. Man kann vermuten, daß dieser suchende Komponist heute ein begeisterter Anhänger der aktuellen Computerelektronik wäre. Eines der Elemente der revolutionären Elektronischen Musik ist, wenn man schon nicht das Geräusch als Grundlage nimmt, der gleitende Klang. Nicht zu definieren, nicht zu benennen, zerstört er radikal unser diskontinuierliches Denken in rationalisierten bestimmten Tonhöhen. Thomas Mann bemerkt nun in seinem Roman zu dieser Frage folgendes: "Wir wissen alle, daß es das erste Anliegen der Tonkunst war, den Klang zu denaturieren, den Gesang der ursprünglich-urmenschlich ein Heulen über viele Tonstufen hinweg gewesen sein muß, auf einer einzigen festzuhalten und dem Chaos das Tonsystem abzugewinnen. Gewiß und selbstverständlich: Eine normierende Maßordnung der Klänge war Voraussetzung und erste Selbstbekundung dessen, was wir unter Musik verstehen. In ihr stehengeblieben, sozusagen als ein naturalistischer Atavismus, als ein Rudiment aus vormusikalischen Tagen ist der Gleitklang, das Glissando, in dem man immer eine antikulturelle, ja antihumane Dämonie abzuhören geneigt war." Der Ton als Denaturierungsvorgang. Die Frage bleibt: Samplen wir das Heulen des Windes und kommen damit
zu einer selbstgemachten Musik oder wählen wird aus der unendlichen
Zahl von Naturheulern eine endliche Zahl von musikalischen Elementen aus,
ob wir sie Töne nennen oder GM, d.h. bestimmte Instrumente nennen.
Das nächste Jahrtausend wird zeigen, wohin der Weg geht.
↑
Rückseite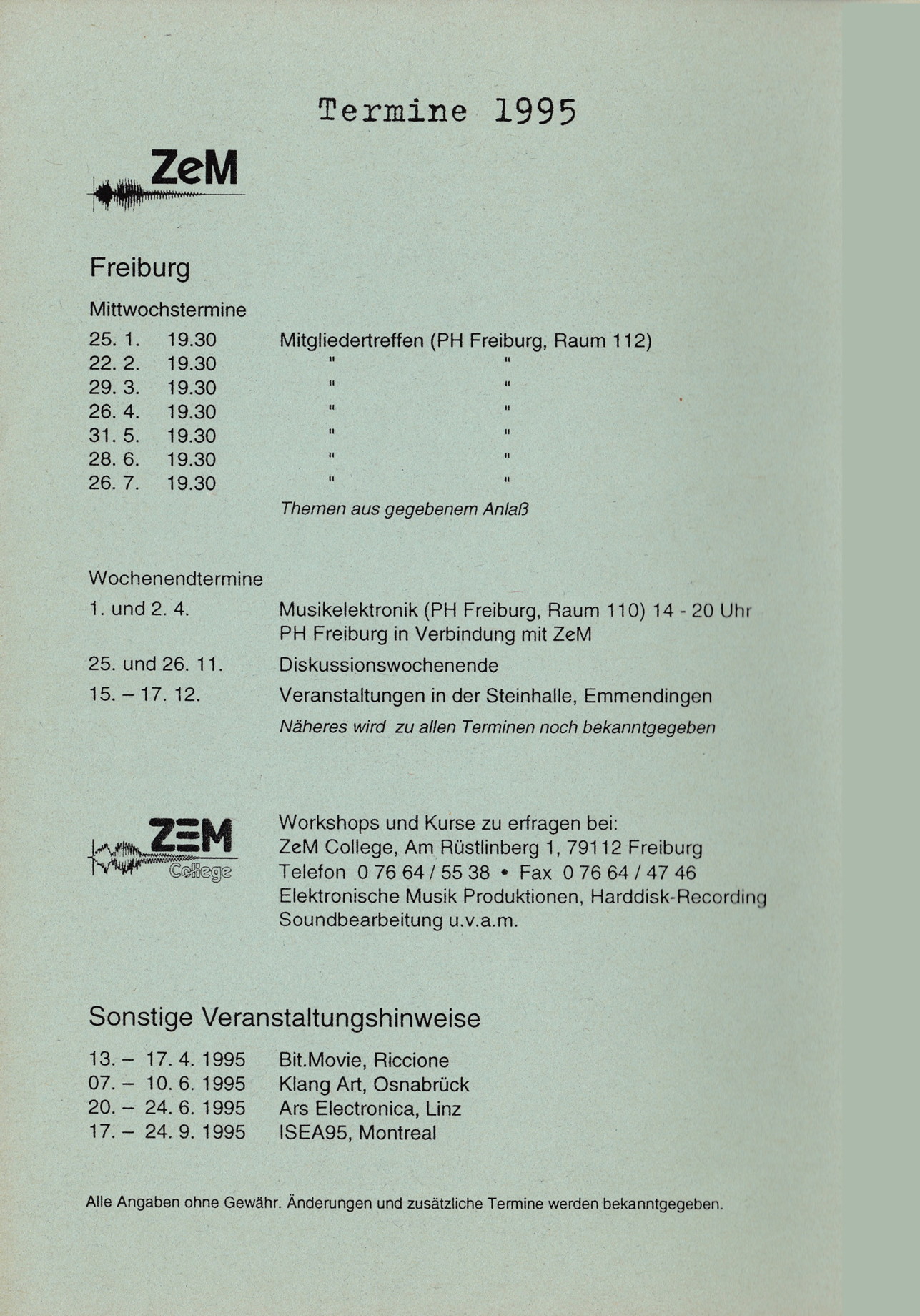
|
|
© ZeM e.V. | ZeM Mitteilungsheft Nr. 16 - Januar 1995
|